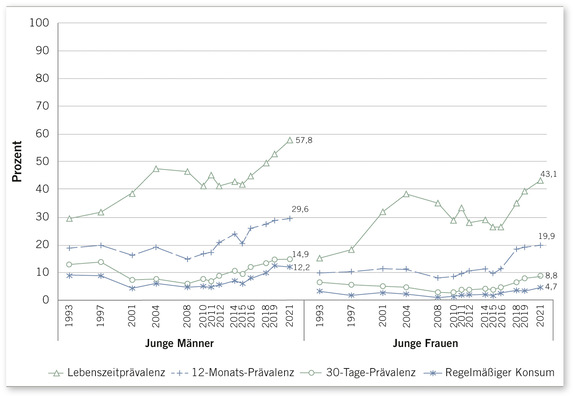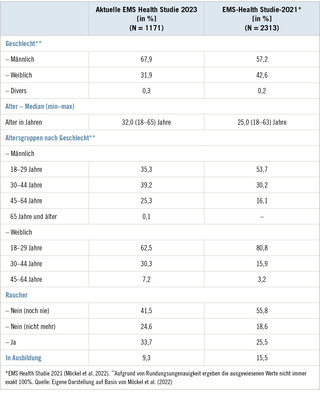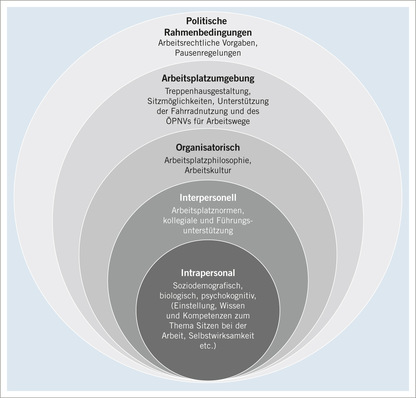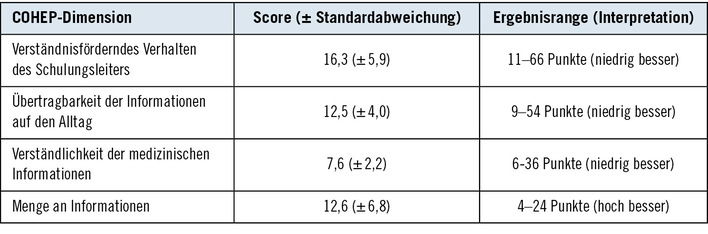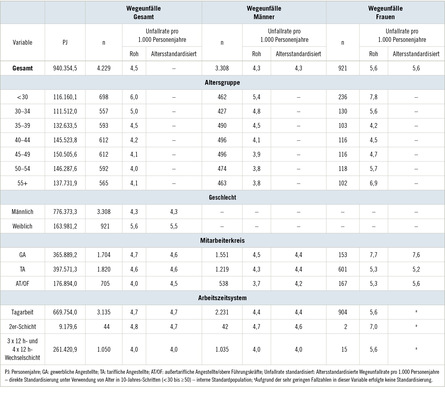Ich mache also Peer Reviews. Wie ich dazu gekommen bin? Nun, ich habe früher selbst viel publiziert. Die Betonung liegt auf viel. Man könnte mich auch als Polyscribent bezeichnen. Ganz ehrlich, von meinen über 150 Originalarbeiten sind vielleicht maximal fünf erwähnenswert. Meine Expertise lag mehr darin, Masse zu produzieren. Das erreicht man dadurch, dass man mehrere Themen bearbeitet und die daraus resultierenden Veröffentlichungen mehrfach vermarktet: Eine deutsche und eine englische Version, eine andere Überschrift, eine neue Einleitung oder ein Review, in dem die eigenen Ergebnisse nicht im Vordergrund stehen. Beliebt ist es auch, die Studienergebnisse auf mehrere Einzelpublikationen zu verteilen. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass man noch mehr Koautoren mit aufnehmen kann. Manch einer, der da oben auf der Ver-öffentlichung steht, hat nicht einmal den Text der Arbeit gelesen. Koautoren sind wichtig, weil sie mit dafür sorgen, dass man selbst als Koautor in deren Arbeiten erscheint und weil sie motiviert sind, die Arbeiten des anderen Autors zu zitieren. Das ist entscheidend für den Impact-Faktor, den Katalysator für akademische Karrieren.
Ich glaube also, dass ich mich ganz gut auskenne, wenn es um die Prinzipien des wissenschaftlichen Publizierens geht. Natürlich gibt es einige wenige Spezialthemen, die ich auch in der Tiefe ganz gut beherrsche. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich mich in allen Forschungsbereichen auskenne, die Gegenstand der mir vorgelegten Arbeiten sind. Warum mir solche Arbeiten überhaupt vorgelegt werden? Weil ich schnell bin. Ich will den Vorgang so schnell wie möglich von meinem Schreibtisch kriegen. Und ich bin nicht nachtragend, wenn mir der Chefredakteur mitteilt, dass eine von mir in abgelehnte Arbeit nun doch erscheinen würde, weil gerade eine Einreichungsflaute vorliegt und er das Heft füllen müsse, oder weil er mit dem Autor geredet hat. Ist alles sowieso nicht so wichtig. Es wird geschätzt, dass ungefähr 90 Prozent aller wissenschaftlicher Publikationen Themen behandeln, die bereits in anderen Veröffentlichungen ausreichend behandelt worden sind.
Wie ich vorgehe, wenn ich einen Artikel begut-achte? Ganz einfach, ich schaue mir als Erstes an, wer der Hauptautor ist und welcher For-schungseinrichtung er angehört. Da gibt es einige Provenienzen, die absolut unverdächtig und sind und Seriosität garantieren. Früher habe ich dann immer noch im Literaturverzeichnis nachge-schaut, ob eine meiner Arbeiten zitiert worden ist. Falls ja, gab das natürlich Pluspunkte. Aber meine fünf herausragenden Arbeiten sind sowieso in den ewigen Jagdgründen der Wissenschaft verschwunden. Gnädig stimmen mich auch eine klare Diktion mit kurzen Sätzen und ein guter Duktus. Das Masterpiece hierbei ist die Zusammenfassung. Später wird überwiegend nur der Abstract gelesen werden. Sehr ungehalten werde ich, wenn das Manuskript nicht den redaktionellen Vorgaben unseres Journals entspricht, was übrigens bei den meisten eingereichten Arbeiten mehr oder weniger der Fall ist. Wütend machen mich fehlerhafte Orthographie und mangelhafte Interpunktion. Partielle Analphabeten können keine seriöse Wissenschaft abliefern. Sie sehen, meine Hauptkriterien sind meist die Formalien.
Insgesamt hat sich das medizinische Wissen vervielfacht. Das hat zu zahlreichen Subspezialisierungen geführt. Es wird immer schwieriger, den Peer zu finden, der die Kenntnisse hat, Arbeiten zu Themen aus dem Mikrokosmos der Arbeitsmedizin zu bewerten. Hierzu passen einige Pressemeldungen der jüngsten Vergangenheit. Eine neue Qualität des Peer-Reviews zeigte sich in einer Affäre, die u. a. den Springer Wissenschaftsverlag heimsuchte. Hier waren zum einen unter falscher Internet-Identität Autoren ihre eigenen Gutachter. Zum anderen wurden Gutachter unter falschen Mailadressen benannt. Die Peer Reviews stammten also aus einer unbekannten Quelle. Springer hat deswegen bislang 64 bereits publizierte Studien zurückgezogen.
Ach übrigens: Als ich noch wissenschaftlich aktiv war, konnte man beim Peer Review einige für die eigenen Veröffentlichungen wertvolle Anregungen erhalten und als seine eigene Ideen verkaufen. Der eine oder andere Gutachter machte damit auch Politik, indem er die Veröffentlichung von für ihn unbequemen oder konkurrierenden Arbeiten zumindest verzögerte, wenn nicht gar verhinderte. Doch nunmehr bin ich ein zahnloser Tiger. Warum ich dann überhaupt noch begutachte? Gute Frage. Wahrscheinlich weil es eines der wenigen Instrumente darstellt, noch ein wenig mitzureden, und sei es auch nur aus dem Untergrund. Brotlos ist der Job seit eh und je.
Schreiben Sie uns!
Ironymus freut sich auf Ihre Beiträge!
E-Mail: ironymus@hvs-heidelberg.de
Die Zuschriften werden selbstverständlich anonym behandelt. Diese werden die nächsten Glossen entscheidend prägen.