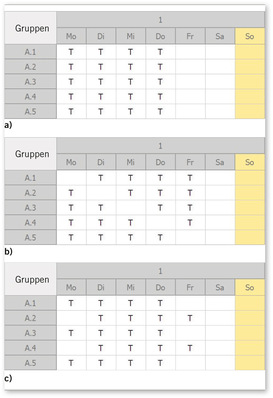Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.
No assumption of costs for gender reassignment measures
The Federal Social Court (BSG) has abandoned its previous case law on gender reassignment surgery for transsexualism. The diagnosis and treatment of psychological distress caused by gender incongruence is a new examination and treatment method that is subject to the prohibition with reservation of permission in § 135 SGB V. § 135 SGB V therefore also has a blocking effect for other persons until a guideline is submitted by the GBA.
Keine Kostenübernahme für geschlechtsanpassende Maßnahmen
Das Bundessozialgericht (BSG) gibt seine bisherige Rechtsprechung zu geschlechtsangleichen Operationen bei Transsexualismus auf. Bei der Diagnose und Behandlung eines durch Geschlechtsinkongruenz verursachten Leidensdrucks handele es sich um eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode, die dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt des § 135 SGB V unterfalle. § 135 SGB V entfalte daher eine Sperrwirkung auch für andere Personen bis zur Vorlage einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA).
Kernaussagen
Sachverhalt
Die Beteiligten streiten um einen Anspruch auf Kostenübernahme für eine beidseitige Mastektomie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Die klagende Person wurde 1997 als Frau geboren und ist bei der beklagten Krankenkasse (KK) gesetzlich krankenversichert. Unter der Rubrik „Geschlecht“ ist für sie im Personenstandsregister seit Oktober 2019 „ohne Angabe“ eingetragen. Am 04.12.2019 beantragte sie eine Mastektomie beider Brüste und stützte sich dafür auf einen Arztbrief, der eine transidentitäre Geschlechtsidentitätsstörung diagnostizierte.
Die Beklagte lehnte den Antrag mit der Begründung ab, das Vorliegen eines manifestierten Transsexualismus sei nicht belegt. Im Widerspruchsverfahren legte die klagende Person ein Indikationsschreiben ihrer Psychotherapeutin sowie ein Attest ihrer Hausärztin vor und teilte mit, sie leide an einer Geschlechtsidentitätsstörung; die Diagnose Transsexualismus treffe auf sie als non-binäre Person nicht zu. Der von der Beklagten eingeschaltete Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) kam zu dem Ergebnis, es bestünden eine Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet (F64.9), sowie Anpassungsstörungen. Außer bei Transsexualität gebe es keine Grundlage für eine geschlechtsangleichende Operation. Am 28.05.2020 ließ die klagende Person die Mastektomie stationär durchführen und zahlte dafür 5305,32 Euro. Die Beklagte wies den Widerspruch zurück (Widerspruchsbescheid vom 22.10.2020).
Das Sozialgericht (SG) hat der Klage gegen den negativen Widerspruchsbescheid stattgegeben. Der Anspruch transgeschlechtlicher Personen auf Operationen am gesunden Körper gelte unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes auch für non-binäre Personen. Das Landessozialgericht (LSG) hat das SG-Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die Revision blieb ohne Erfolg.
Bei der ambulanten Diagnostik nebst Behandlungsplanung und der sich anschließenden stationären Behandlung eines durch Geschlechtsinkongruenz bedingten Leidensdrucks durch irreversible chirurgische Eingriffe (hier: durch Mastektomie) handele es sich um eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode i. S. des § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Auf diese bestehe ein Anspruch erst, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) eine entsprechende Empfehlung abgegeben hat.
Krankheit im Sinne der GKV?
Die Voraussetzungen für die Erstattung der Kosten einer Krankenbehandlung gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 Alt 2 i. V. m. § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V lägen nicht vor. Zur Zeit der Leistungsablehnung und Selbstbeschaffung habe kein Anspruch der klagenden Person auf Durchführung einer beidseitigen Mastektomie zu Lasten der GKV bestanden.
Das SGB V sehe (bislang) keinen eigenständigen, vom Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Krankheit unabhängigen, Anspruch von Transpersonen auf körpermodifizierende Behandlungen vor, wie ihn etwa § 27a SGB V für die künstliche Befruchtung regele. Der Begriff der Krankheit sei im Hinblick auf den ständig voranschreitenden medizinischen Forschungs- und Erkenntnisstand sowie den fortlaufenden Wandel der gesellschaftlich-kulturellen Anschauungen wertungsoffen. Die Bestimmung des Leitbildes des gesunden Menschen bedürfe daher – gerade in Grenz- und Zweifelsfällen – einer wertenden Einordnung und einer am Demokratieprinzip orientierten Entscheidung, ob ein Zustand regelwidrig ist, d.h. vom Leitbild abweicht. Im Grenzbereich zwischen Krankheit im Sinne der GKV und der durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) geschützten geschlechtlichen Identität obliegt es daher zuvörderst dem parlamentarischen Gesetzgeber, die Leistungsansprüche der GKV unter Berücksichtigung der vorherrschenden gesellschaftlich-kulturellen Anschauungen für bestimmte körperliche oder psychische Zustände zu regeln. Eine solche Regelung existiere für geschlechtsangleichende Behandlungen bislang nicht.
Anspruch auf Krankenbehandlung?
Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.
Unter „Krankheit“ im Rechtssinne verstehe die Rechtsprechung einen regelwidrigen, vom Leitbild des gesunden Menschen abweichenden Körper- oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder die Betroffenen2 arbeitsunfähig macht. Auf eine Legaldefinition dieses Begriffs sei seit jeher verzichtet worden. In Abwesenheit konkreter gesetzlicher Regelungen zu Leistungsansprüchen bei bestimmten körperlichen oder geistigen Zuständen sei es Aufgabe der Rechtsprechung, die beschriebenen Wertungsspielräume bei der Auslegung des Begriffs der Krankheit i. S. des § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V zu füllen. Die Interpretation des Begriffsinhalts durch Auslegung erfolge bei normativen Begriffen – wie hier dem der Krankheit – regelmäßig teleologisch, d. h. mit Blick auf den mit der Norm verbundenen Zweck.
Eingriff in gesundes Organ
Nach der Rechtsprechung des Senats setze der Anspruch auf eine Versorgung, die mit einem Eingriff in ein gesundes Organ verbunden ist, eine besondere Rechtfertigung voraus. Dabei seien Art und Schwere der Erkrankung, die Dringlichkeit der Intervention, die Risiken und der zu erwartende Nutzen der Therapie sowie etwaige Folgekosten für die GKV gegeneinander abzuwägen. Allein der Wunsch, das äußere Erscheinungsbild zu verändern, genüge nicht. Das subjektive Empfinden der Versicherten allein könne die Regelwidrigkeit und die daraus abgeleitete Behandlungsbedürftigkeit ihres Zustands nicht begründen. Maßgeblich seien vielmehr objektive Kriterien, nämlich der vom Gesetzgeber zum Maßstab erklärte allgemein anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse. Auch ein durch das äußere Erscheinungsbild verursachter Leidensdruck und das Bedürfnis nach Behebung oder Linderung einer hieraus resultierenden psychischen Störung rechtfertigten nach der Rechtsprechung des Senats für sich genommen noch keinen Anspruch auf einen Eingriff in ein gesundes Organ. Maßgeblich sei insoweit die wissenschaftliche Bewertung der generellen psychotherapeutischen Eignung chirurgischer Eingriffe. Erforderlich sei hier auch eine klare Grenzziehung zu Schönheitsoperationen, für deren Kosten die Versichertengemeinschaft gerade nicht aufkommen solle.
Transsexualismusrechtsprechung
Das BSG habe in seiner bisherigen Rechtsprechung zu geschlechtsangleichenden Operationen bei Transsexualismus eine behandlungsbedürftige psychische Krankheit angenommen. Voraussetzung dafür war, dass psychiatrische und psychotherapeutische Mittel das Spannungsverhältnis zwischen dem körperlichen Geschlecht und der seelischen Identifizierung mit einem anderen Geschlecht nicht zu lindern und zu beseitigen vermögen. Anknüpfend an die Wertungen des Transsexuellengesetzes (TSG) habe es bei einem behandlungsbedürftigen Transsexualismus ausnahmsweise einen Anspruch auf Operationen an für sich genommen gesunden Organen angenommen, wenn diese der Annäherung an einen „regelhaften Zustand“ im Sinne eines männlichen oder weiblichen Phänotyps dienten.
Transidentität keine Krankheit
Der Senat halte hieran nicht mehr fest. Der Rechtsprechung des Senats zu Operationen an gesunden Organen ausschließlich zur Angleichung an das weibliche oder das männliche Geschlecht stehe einerseits die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Personenstandsrecht entgegen. Danach ist auch die geschlechtliche Identität von Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen, vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG geschützt. Andererseits spreche viel dafür, dass die bislang angenommene Beschränkung auf zwei biologische Geschlechter im binären System nicht mehr dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand entspreche. Dies lege jedenfalls die aktuelle S3-Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung und Behandlung“ nahe (im Folgenden S3-Leitlinie). Die S3-Leitlinie richte sich ausdrücklich gleichermaßen an die medizinische Versorgung von Personen mit einer weiblichen, männlichen oder non-binären Geschlechtsidentität und verweise auf die im Mai 2013 veröffentlichte 5. Fassung des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5), die neben dem traditionellen Begriff des „Gegengeschlechts“ weitere Geschlechtsformen („alternative gender“) in die Diagnostik einer Geschlechtsdysphorie einschließe. Die S3-Leitlinie gehe davon aus, dass eine Transidentität beziehungsweise Geschlechtsinkongruenz, bei der das eigene Geschlechtsempfinden nachhaltig in Widerspruch zu dem nach den Geschlechtsmerkmalen zugeordneten Geschlecht stehe, an sich keine „Krankheit“ in Form eines behandlungsbedürftigen regelwidrigen Körper- oder Geisteszustands darstelle. Sie sehe für die Bestimmung des Umfangs der erforderlichen Behandlung aber den durch die Geschlechtsinkongruenz begründeten, klinisch-relevanten Leidensdruck als maßgeblich an.
Ob bei der klagenden Person ein durch Geschlechtsinkongruenz bedingter Leidensdruck vorläge, zu dessen Heilung, Linderung oder Verhütung der Verschlimmerung die streitgegenständliche Mastektomie unter Berücksichtigung des für Eingriffe in ein gesundes Organ geltenden – strengen – Maßstabs notwendig war, könne der Senat auf Grundlage der Feststellungen des Landessozialgerichts (LSG) nicht abschließend entscheiden. Dies könne hier jedoch offenbleiben. Denn ein Anspruch scheide derzeit jedenfalls mangels Empfehlung durch den GBA nach § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V aus.
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Bei der Diagnose und Behandlung eines durch Geschlechtsinkongruenz verursachten Leidensdrucks handelt es sich um eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode, die dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt nach § 135 SGB V unterfalle. Das bedeutet, dass eine Handlung grundsätzlich untersagt ist, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Erlaubnis vor.
§ 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V bestimme: „Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dürfen in der vertragsärztlichen … Versorgung zu Lasten der Krankenkassen nur erbracht werden, wenn der GBA … in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V Empfehlungen abgegeben hat über die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der neuen Methode sowie deren medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit …“.
Einer solchen Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V bedürfe es auch in Fällen wie dem vorliegenden. Denn die Mastektomie zur Behandlung eines durch eine Geschlechtsinkongruenz verursachten Leidensdrucks sei untrennbarer Bestandteil einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode, für deren Wirkprinzip der in der vertragsärztlichen Versorgung liegende Leistungsanteil wesentlich sei. An einer solchen Richtlinie fehle es.
Bewertung neuer Methoden
Der Begriff der „Behandlungsmethode“ beschreibe eine medizinische Vorgehensweise, der ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept zugrunde liege, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheide und das ihre systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen solle. Die Prüfung und Bewertung durch den GBA habe dabei nicht einzelne ärztliche Maßnahmen zum Gegenstand, die nur Bestandteil eines methodischen Konzepts seien, sondern beziehe sich auf leistungsübergreifende methodische Konzepte, die auf ein bestimmtes diagnostisches oder therapeutisches Ziel ausgerichtet seien. Das theoretisch-wissenschaftliche Konzept einer Methode beschreibe die systematische Anwendung bestimmter auf den Patienten einwirkender Prozessschritte (Wirkprinzip), die das Erreichen eines diagnostischen oder therapeutischen Ziels in einer spezifischen Indikation (Anwendungsgebiet) wissenschaftlich nachvollziehbar erklären könne.
Nach der Rechtsprechung des Senats sei eine Behandlungsmethode „neu“, wenn sie (bisher) nicht als abrechnungsfähige ärztliche Leistung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen (EBM-Ä) enthalten sei oder wenn sie zwar im EBM-Ä aufgeführt sei, deren Indikation aber wesentliche Änderungen oder Erweiterungen erfahren habe. Sinn und Zweck der Methodenbewertung nach § 135 Abs. 1 SGB V bestehe vor allem darin, Wirksamkeit und Qualität der vertragsärztlichen Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen vor ihrer Anwendung sicherzustellen und dadurch die Gesundheit der Patienten und die Beiträge der Versicherten zu schützen.
Schutzzweck der GBA-Prüfung
Nach diesem Schutzzweck sei es Aufgabe des GBA als fachkundig besetztem Gremium, Methoden auf Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zu bewerten. Seine Aufgabe sei es auch, die sachgerechte Anwendung der neuen Methode durch die Aufstellung von Qualifikationsanforderungen zu sichern. Der GBA bürge nach der Konzeption des Gesetzes für die erforderliche Verbindung von Sachkunde und interessenpluraler Zusammensetzung. Dies rechtfertige es, diesem Gremium im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die für jede untergesetzliche Normsetzung kennzeichnende Gestaltungsfreiheit zukommen zu lassen.
Das Gesetz übertrage dem GBA dabei nicht nur die Kompetenz zur Entscheidung über die Methodenanerkennung, sondern gebe ihm zugleich auf, die notwendigen Qualifikationsregelungen zu treffen. Die Notwendigkeit der mit § 135 SGB V verfolgten Qualitätssicherung könne sich aus einer neuartigen, bisher nicht erprobten Wirkungsweise einer Behandlung, aus der Komplexität des Ablaufs oder aus dem Vorliegen unbekannter, bisher nicht ausreichend erforschter Risiken ergeben. Dem liege die Erwägung zugrunde, dass vielfach die Eignung eines neuen Diagnose- beziehungsweise Behandlungsverfahrens nicht unabhängig davon beurteilt werden könne, welcher Arzt mit welcher Qualifikation diese Leistung erbringen soll. Die Entscheidung darüber, ob eine neue Methode auch im Vergleich zu bereits zu Lasten der Krankenkassen (KKn) erbrachten Methoden wirtschaftlich sei, könne davon abhängen, wie hoch nach den bisherigen Erfahrungen die Wahrscheinlichkeit von Fehldiagnosen sei. Dies wiederum werde auch davon beeinflusst, über welche Erfahrungen und Kenntnisse die Ärzte verfügen müssen, die das neue Verfahren anwenden. Die Notwendigkeit einer (Über-)Prüfung nach § 135 Abs. 1 SGB V könne sich aber auch aus geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, die ein von der Rechtsprechung – wie hier – ohne Einbeziehung des GBA im Grundsatz gebilligtes bisheriges Untersuchungs- und Behandlungskonzept in der bisherigen Form nicht mehr zulassen.
Neue Behandlungsmethode
Die Diagnostik und Behandlung von durch Geschlechtsinkongruenzen verursachtem Leidensdruck stellten danach eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode dar.
Der Senat gehe dabei davon aus, dass die ärztliche Praxis sich an dem in der aktuellen S3-Leitlinie zusammengetragenen wissenschaftlichen Erkenntnisstand orientiere, der einem theoretisch-wissenschaftlichen Konzept folge, das die systematische Anwendung bestimmter auf den Patienten einwirkender Prozessschritte (Wirkprinzip) zur Erreichung eines diagnostischen oder therapeutischen Ziels in einer spezifischen Indikation (Anwendungsgebiet) wissenschaftlich nachvollziehbar erkläre. Aufgrund der aufgezeigten geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen und der neueren medizinischen Bewertungen, wie sie insbesondere in der S3-Leitlinie beschrieben sind, könne die Behandlung nicht mehr ausschließlich an normativ vorgegebenen Phänotypen (männlich/weiblich) ausgerichtet werden. Die bisherige BSG-Rechtsprechung zu sogenannten Transsexuellen basiere aber auf den klar abgrenzbaren Phänotypen des weiblichen und männlichen Geschlechts – anknüpfend an die darauf basierenden gesetzlichen Regelungen im TSG und in § 116b SGB V zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Die jeweilige Behandlung (Frau-zu-Mann-Transformation und Mann-zu-Frau-Transformation) sei damit der Bewertung anhand eines objektiven Maßstabs zugänglich gewesen.
Die Diagnostik und Behandlung von durch Geschlechtsinkongruenzen jedweder Art verursachtem Leidensdruck stelle deshalb zwangsläufig auch eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode dar. Die aktuelle wissenschaftliche Bewertung, wie sie insbesondere in der S3-Leitlinie referiert werde, beziehe die Vielfalt aller – auch non-binärer – Geschlechtsidentitäten ein, ohne dass auf einen normativ vorgegebenen Phänotyp, der mit der Behandlung angestrebt werden solle, zurückgegriffen werden könne. Stattdessen müssten sowohl die Geschlechtsinkongruenz individuell festgestellt als auch das darauf aufbauende Behandlungskonzept und das jeweilige Behandlungsziel unter Berücksichtigung des bestehenden Leidensdrucks individuell festgelegt werden. Die aktuelle S3-Leitlinie greife insoweit auf das Konzept der „partizipativen Entscheidungsfindung“ zurück. Die Transpersonen sollten gemeinsam mit den Behandelnden alle Vor- und Nachteile abwägen und ihre Entscheidungen für oder gegen einzelne Behandlungen oder Behandlungsschritte im Austausch mit den Behandelnden treffen. Falls eine gemeinsame Entscheidung nicht möglich sei, sollten die zugrunde liegenden Gründe offen besprochen werden. Darüber hinaus gehe die S3-Leitlinie davon aus, dass den Behandelnden in Bezug auf die Diskrepanz zwischen Gender (Geschlechtsidentität, Geschlechterrolle) und Zuweisungsgeschlecht keine objektiven Beurteilungskriterien zur Verfügung stünden und die Feststellung daher zunächst von der behandlungsbedürftigen Person selbst getroffen werde. Dies beschreibe ein Konzept, das Patient und Arzt nicht nur gleichberechtigt in die Diagnosestellung und Behandlung einbinde, sondern darüber hinaus der behandlungsbedürftigen Person eine Schlüsselrolle dahingehend zuweise, dass diese in Ermangelung objektiver Kriterien zwingend zunächst selbst die Feststellung der Inkongruenz vorzunehmen habe. Schon deswegen weiche das Konzept methodisch von anderen Behandlungsverfahren ab. Die Kriterien für die medizinische Notwendigkeit einer geschlechtsangleichenden Operation seien danach nicht nach objektiven – einem Sachverständigengutachten zugänglichen – Maßstab vorgegeben. Vielmehr werde Behandler und Patient ein gemeinsamer Entscheidungsspielraum zugestanden.
Fehlen objektiver Maßstäbe
Das Fehlen objektiver Kriterien führe dazu, dass dem methodischen Vorgehen bei dem beschriebenen Zusammenwirken zwischen Arzt und Patient entscheidende Bedeutung zukomme. Die Bestimmung des Behandlungsziels werfe dabei insbesondere bei non-binären Geschlechtsinkongruenzen grundsätzliche Fragen auf. Denn es gehe hier nicht zwingend um die Annäherung an das äußere Erscheinungsbild eines normativ vorgegebenen Geschlechts. Die negative Abgrenzung von einem bestehenden Zustand, wie hier die Abwendung vom weiblichen Geschlecht, beantworte nicht die Frage, welcher Zustand erreicht werden soll und muss, um den bestehenden Leidensdruck zumindest zu mindern. In Anbetracht der (in der Regel) irreversiblen Folgen von geschlechtsangleichenden Eingriffen und der Komplexität des Diagnose- und Behandlungsverfahrens komme der institutionellen Qualitätssicherung durch den GBA eine besondere Bedeutung zu. Nach dem oben beschriebenen Schutzzweck des § 135 SGB V sei es hier Aufgabe des GBA als fachkundig besetztem Gremium, die Behandlung von durch Geschlechtsinkongruenzen verursachtem Leidensdruck mittels dauerhaft den Körper verändernder Eingriffe und das methodische Vorgehen im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung im vorliegenden Kontext auf Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes zu bewerten. Dieser Erkenntnisstand sei nicht zwingend vollständig und umfassend in der S3-Leitlinie abgebildet. Der GBA habe ihn zu bewerten und die sachgerechte Anwendung der neuen Methode durch die Aufstellung von Qualifikationsanforderungen zu sichern.
§ 135 Abs. 1 SGB V bei stationärem Eingriff
Der Anwendbarkeit des § 135 Abs. 1 SGB V stehe nicht entgegen, dass hier um Kostenerstattung für eine Mastektomie und damit einen stationär durchgeführten Eingriff, gestritten werde. Denn der Erlaubnisvorbehalt des § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V gelte auch für Methoden, die auf einer Kombination mehrerer Komponenten beruhen, die nur in ihrer Zusammenschau das Wirkprinzip der Krankenbehandlung beschreiben und für den Erfolg der Therapie verantwortlich sind. Der Schutzzweck des § 135 Abs. 1 SGB V gebiete die Einbeziehung in den Methodenbewertungsvorbehalt auch in Fällen, in denen die ambulant erbrachte Komponente einen für das Wirkprinzip der Krankenbehandlung wesentlichen Leistungsanteil hat. So habe das BSG etwa Hilfsmittel in den Methodenbewertungsvorbehalt einbezogen, deren Anwendung zur Sicherung des Erfolgs der Krankenbehandlung ein Behandlungskonzept zugrunde liege, bei dem Anlass zur Beurteilung durch den GBA bestehe. So liege der Fall hier.
Die vertragsärztliche Diagnostik und ihre über den ambulanten Bereich hinausweisende Behandlungsplanung sei bei Transitionsbehandlungen (sowohl bei non-binären als auch binären Personen) untrennbar mit den angedachten – auch stationären – Behandlungsmaßnahmen verbunden. Die vorgreiflichen Entscheidungen im ambulanten Bereich steuerten maßgeblich die gesamte Behandlung. Die Gesundheitsversorgung für Transmenschen im Zuge einer Transition finde entweder zentral an einem Klinikum oder im vertragsärztlichen Bereich in Schwerpunktpraxen niedergelassener Ärzte und psychologischer Psychotherapeuten statt (S3-Leitlinie, S. 5). Der therapeutische Prozess zur Entwicklung des gewünschten Behandlungsziels sei den Einzelmaßnahmen (z.B. Hormonbehandlung, Epilation, Logopädie, Phonochirurgie, Adamsapfelkorrektur, Perücken und andere Hilfsmittel, Genitaloperationen oder eben Brustoperationen) konzeptionell vorgeschaltet. Zentraler Ausgangspunkt sei das Behandlungskonzept als Ganzes, aus dem sich die Indikation für einzelne Maßnahmen ableite. Insoweit komme es nicht darauf an, ob die chirurgische Umsetzung der im Hinblick auf das Behandlungsziel geplanten Eingriffe für sich betrachtet (hier: die isoliert betrachtete Mastektomie) bereits dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspreche.
Vertrauensschutz
Eine danach erforderliche Richtlinie des GBA nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V liege (bislang) nicht vor, so dass die Beklagte die hier streitige Leistung für die klagende Person nicht erbringen durfte. Ein Kostenerstattungsanspruch der klagenden Person ergebe sich auch weder unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Systemversagens noch liege ein Seltenheitsfall vor (wird ausgeführt). Der aus Art. 20 Abs. 3 GG hergeleitete Grundsatz des Vertrauensschutzes könne allerdings gebieten, einem durch die bisherige Rechtsprechung begründeten Vertrauenstatbestand im Einzelfall Rechnung zu tragen. Insoweit liege es nahe, dass die KKn für bereits begonnene Behandlungen von Transsexuellen aus Gründen des Vertrauensschutzes die Kosten wie bisher weiterhin zu übernehmen haben.
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.