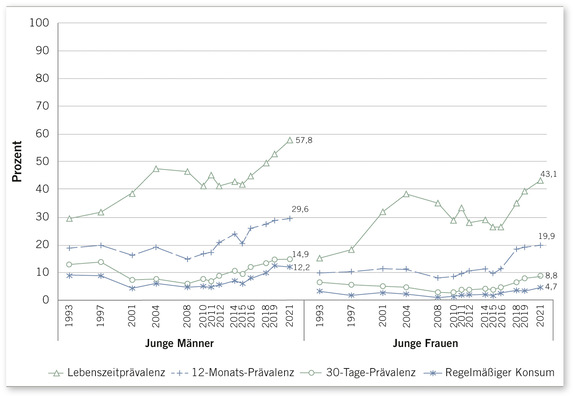Sachverhalt
Die Beteiligten streiten darüber, ob die Tätigkeit des Klägers als Kardiologe in der Klinik der Beigeladenen der Sozialversicherungspflicht unterlag. Der Kläger ist Facharzt für Innere Medizin und war dort in dem Zeitraum vom 16. Januar bis 17. Februar 2012 in der kardiologischen Abteilung als „Honorararzt“ tätig. Das Vertragsverhältnis war durch die Vermittlung einer Agentur zustande gekommen. Für die etwa einmonatige Tätigkeit erhielt der Kläger ein Entgelt in Höhe von 17.977,50 €. Die Arbeitsstunde wurde mit 90 € vergütet. In dem Honorararztvertrag war u.a. Folgendes geregelt:
Vertragsbedingungen
„(1) Der Auftraggeber beauftragt den Honorararzt im Rahmen seiner fachlichen Qualifikation mit der ärztlichen Betreuung und Behandlung von Patienten in der kardiologischen Abteilung des vorbezeichneten Krankenhauses, ohne dass dadurch ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des §7 SGB IV begründet wird.
(2) Die zu erbringende Dienstleistung beinhaltet die eigenständige ärztliche Versorgung der Patienten in kooperativer Zusammenarbeit mit den angestellten Ärzten und dem Pflegepersonal des Krankenhauses.
(3) Der Honorararzt ist nicht verpflichtet, bestimmte Dienstzeiten zu übernehmen. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, der Übernahme bestimmter Dienstzeiten durch den Honorararzt zuzustimmen.
(4) Der Honorararzt hat keinen Honoraranspruch auf seine durch Krankheit oder Unfall ausgefallenen Dienstzeiten.
(5) Der Honorararzt ist für die ordnungsgemäße medizinische Behandlung unter Einhaltung der jeweils aktuellen medizinischen Sorgfalt eigenständig verantwortlich und zur höchstpersönlichen Leistungserbringung verpflichtet. Der Honorararzt ist nicht in die Organisationsstruktur der Klinik eingebunden. Der Honorararzt ist in seiner Berufsausübung frei und nicht den Weisungen des Auftraggebers unterworfen. Seinerseits hat der Honorararzt ein medizinisch-fachliches Weisungsrecht gegenüber dem nachgeordneten Arzt- und Pflegepersonal. Soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist, hat der Honorararzt die fachlichen und organisatorischen Vorgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen. Der Auftraggeber hat insbesondere keine Weisungsbefugnis hinsichtlich der Gestaltung der Dienstzeiten. Diese werden zwischen Auftraggeber und Honorararzt gemeinsam festgelegt und schriftlich dokumentiert.
(6) Der Honorararzt erbringt die vereinbarte Dienstleistung grundsätzlich mit den von ihm zu stellenden Hilfsmitteln. Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Honorararzt die zur Erbringung der Dienstleistung notwendigen Hilfsmittel des Klinikums verwendet. Die Zurverfügungstellung erfolgt in diesem Fall unentgeltlich. Dies gilt auch für die vom Honorararzt zu tragende Dienstkleidung.
(7) Der Honorararzt erhält für seine Tätigkeit ein Honorar in Höhe von 90 € pro tatsächlich geleisteter Stunde. Eine Verpflichtung zur Honorarzahlung bei Dienstverhinderung des Honorararztes besteht nicht.
(8) Dem Honorararzt wird für die Dauer dieses Vertrages eine angemessene Unterkunft zur Verfügung gestellt.“
Auf Nachfrage hatte die beigeladene Klinik mitgeteilt, dass auch festangestellte Mitarbeiter im gleichen Fachgebiet beschäftigt würden. Die Honorarärzte seien nicht in das Ausbildungsprogramm integriert. Es erfolge keine Einbindung in die Funktionsbereiche. Die Zuweisung der Patienten geschehe situationsabhängig nach den Erfordernissen der im Stationsdienst zu behandelnden Patienten, z.B. nach Zimmern (Patienten aus Zimmer 1 bis 5). Die Stellung einer Ersatzkraft könne grundsätzlich vom Auftragnehmer erfolgen, sei aber aufgrund der fachlichen Qualifikation mit der Beigeladenen abzustimmen. Eine Verpflichtung zur Übernahme von Urlaubs- und Krankheitsvertretung bestehe nicht.
Letztentscheidungsrecht des Chefarztes
Das Letztentscheidungsrecht liege beim Chefarzt, weil der Chefarzt unter anderem die medizinische Verantwortung des Auftraggebers wahrnehme. Kontrollen fänden grundsätzlich nicht statt. Letztendlich behalte sich der Chefarzt aber Kontrollen vor. Der Kläger übernehme einen Teil der Tätigkeiten aus einer vakanten Oberarztposition. Er nehme aber nicht an den Hintergrunddiensten teil, sondern konzentriere seine Tätigkeit vornehmlich im funktionsdiagnostischen Bereich. Eigene Betriebsmittel würden von dem Kläger nicht eingesetzt. Er sei in den Räumen des Krankenhauses tätig und nutze die dortigen Instrumente wie z.B. ein Röntgengerät oder Sachmittel wie Spritzen/Kanülen usw. Er arbeite in einem multiprofessionellen Team und werde für das Know-how der medizinischen Leistungen bezahlt.
Die beklagte Rentenversicherung stellte mit Bescheiden vom 11. Oktober 2012 sowohl gegenüber dem Kläger als auch gegenüber der Beigeladenen fest, dass es sich bei der Tätigkeit des Klägers als Honorararzt um ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis gehandelt habe.
Gestaltungsfreiheit des Honorararztes
Der Kläger wendet sich gegen die Versicherungspflicht und hat zur Begründung seiner Klage gegen die Statusfeststellung vorgetragen, seine Tätigkeit für die Beigeladene habe ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit beinhaltet. Die Dienste seien nicht durch Weisung angeordnet worden. Er habe nicht an Teambesprechungen teilgenommen und auch keine organisatorischen Aufgaben übernommen. Er habe seine eigene Berufskleidung getragen und ein eigenes Namensschild mit dem Zusatz „Honorararzt“ gehabt.
Für die Einordnung als selbstständige Tätigkeit spreche auch, dass er von der Bundesagentur für Arbeit einen Gründungszuschuss erhalten habe. Er habe Rechnungen für seine Tätigkeit gestellt, wobei lediglich die tatsächlich geleisteten Stunden vergütet worden seien. Einen Anspruch auf Urlaubsgeld oder Lohnfortzahlung habe er nicht gehabt. Sein Honorar habe ein Vielfaches von dem Gehalt eines angestellten Facharztes betragen, das im Monat etwa 7000 € brutto betrage. Auch sei er für weitere Auftraggeber tätig geworden.
Das Sozialgericht zeigte sich von diesen Argumenten überzeugt und stellte unter Aufhebung des Bescheides in seinem Urteil fest, der Kläger sei im streitigen Zeitraum nicht abhängig beschäftigt gewesen sei, da die überwiegenden Merkmale für seine Selbstständigkeit sprächen.
Fehlendes Rechtsschutzinteresse des Klägers
Die Berufung der Beklagten sah das Landessozialgericht (LSG) schon deshalb als begründet, weil bereits das Fehlen des erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses auf Seiten des Klägers einem Erfolg der Klage entgegenstehe. Ein solches Interesse sei nicht feststellen. Selbst wenn die Statusfeststellung der Beklagten aufzuheben sein sollte, wäre nichts dafür ersichtlich, dass mit einer solchen Entscheidung eine Verbesserung der rechtlichen oder wirtschaftlichen Stellung des Klägers einherginge.
Insbesondere drohe dem Kläger keine Heranziehung zu den Beiträgen. Da die Tätigkeit des Klägers bereits vor ca. 6 Jahren beendet und abgerechnet worden sei, könne die Beigeladene den Kläger nach Maßgabe des §28 g SGB IV nicht anteilig zur Beitragszahlung heranziehen. Dies könne nur durch Beitragsabzug erfolgen und darf bei unterbliebenem Abzug nur im Rahmen der nächsten drei Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden. Aber auch unter der Annahme eines fortbestehenden Rechtsschutzinteresses sei die Berufung der Beklagten als begründet anzusehen und die Klage unter Aufhebung des Urteils der 1. Instanz abzuweisen.
Abhängige Beschäftigung
Die Beklagte habe zu Recht festgestellt, dass der Kläger die Tätigkeit als Kardiologe in abhängiger Beschäftigung und damit der Versicherungspflicht unterliegend erbracht habe. Arbeitnehmer ist gem. §7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV, wer von einem Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Erforderlich ist hierzu insbesondere eine Eingliederung in den Betrieb und die Unterordnung unter ein Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeitsausführung umfassendes Weisungsrecht des Arbeitgebers. Das Gesetz bringt diese Grundsätze mit der Formulierung zum Ausdruck, dass Anhaltspunkte für eine Beschäftigung die Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers sind (§7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV). Es genüge, wenn diese Weisungsgebundenheit eingeschränkt und zur „funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess“ verfeinert sei.
Keine dauerhafte Anstellung erforderlich
Vorsorglich sei klarzustellen, dass zum maßgeblichen Tatbestand des §7 Abs. 1 SGB IV weder eine „Festanstellung“ noch der Abschluss eines „typischen“ Arbeitsvertrags zähle. Der gesetzliche Typus eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses umfasse vielmehr eine große Bandbreite von Ausformungen, bei denen sog. „Festanstellungen“ nur einen Teil darstellten. Zu den Tatbestandsmerkmalen einer abhängigen Beschäftigung nach §7 SGB IV gehöre zudem nicht deren Dauerhaftigkeit und erst recht nicht eine von vornherein vereinbarte Dauerhaftigkeit. Auch der Tagelöhner oder Gelegenheitsarbeiter sei regelmäßig abhängig beschäftigt. Bei Einzelaufträgen müsse daher für die Beurteilung, ob der Betroffene in eine vorgegebene Arbeitsorganisation eingegliedert worden sei, auf die Verhältnisse des jeweiligen „Einsatzauftrags“ abgestellt werden.
Vorrang der tatsächlichen Verhältnisse
Die selbständige Tätigkeit sei vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig sei, hänge davon ab, welche Merkmale überwiegen. Maßgebend sei stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Weichten die Vereinbarungen von den tatsächlichen Verhältnissen ab, gäben Letztere den Ausschlag. Ausgangspunkt der Prüfung sei nach ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zunächst das Vertragsverhältnis der Beteiligten, so wie es sich aus den von ihnen getroffenen Vereinbarungen sowie ihrer gelebten Beziehung erschließen lasse. Eine im Widerspruch zur ursprünglich getroffenen Vereinbarungen stehende tatsächliche Beziehung gehe aber der formellen Vereinbarung vor. Mithin gäben die tatsächlichen Verhältnisse den Ausschlag.
Eingliederung in den Krankenhausbetrieb
In der gebotenen Gesamtschau der maßgeblichen Umstände habe ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zwischen dem Kläger und der Beigeladenen bestanden. Selbst wenn sie die jeweiligen Dienste des Klägers im Bereich der kardiologischen Funktionsdiagnostik frei vereinbart hätten, so wäre der Kläger nach Annahme des jeweiligen Dienstes in den Betrieb der Beigeladenen integriert gewesen. Die Beigeladene habe eine verlässliche Erledigung der ihm übertragenen Arbeiten, insbesondere der ihm zugeteilten Patienten erwartete.
Die Beigeladene habe mitgeteilt, dass die Zuweisung der Patienten situationsabhängig nach den Erfordernissen der zu behandelnden Patienten im Stationsdienst zum Beispiel nach Zimmern (Patienten aus Zimmer 1–5) erfolgte. Der Kläger wäre daher in der Auswahl der Patienten, die er behandeln bzw. untersuchen sollte, nicht frei gewesen. Ausweislich der Stundenzettel seien keine erheblichen Schwankungen in der Einteilung der Arbeitszeit ersichtlich gewesen. Bezeichnenderweise wäre sich der Kläger mit der Beigeladenen darüber einig gewesen, dass dieser an seinen Einsatztagen jeweils so lange zu arbeiten hatte, bis alle Belange der – ihm „zugewiesenen“ – Patienten „abgearbeitet“ waren. Damit räume der Kläger selbst ein, dass das Dienstende von sachlichen Notwendigkeiten einer umfassenden Diensterfüllung bestimmt war. Relevante Entscheidungsbefugnisse wären dem Kläger damit nicht zugestanden gewesen.
Anknüpfungstatbestand für eine mögliche die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung sei stets das einzelne angenommene Auftragsverhältnis. Nach Annahme des jeweiligen Auftrags sei der Kläger in den Betrieb der Klinik der Beigeladenen eingebunden gewesen, auch wenn er an Schulungsmaßnahmen und sonstigen Dienstbesprechungen nicht teilnehmen musste. Aus Mitteilung der Beigeladenen gehe hervor, dass der Kläger in einem multiprofessionellen Team gearbeitet habe, in dem er ein fachlich medizinisches Weisungsrecht gegenüber nachgeordneten Ärzten und dem Pflegepersonal innehatte. Jedoch sei von der Beigeladenen mehrfach bekräftigt worden, dass das Letztentscheidungsrecht beim Chefarzt lag. Dabei sei nicht relevant, ob der Kläger in der Ausübung seiner Tätigkeit tatsächlich kontrolliert wurde oder ob und wie oft ggf. der Chefarzt von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht habe. Entscheidend sei allein die Möglichkeit, dass ein Chefarzt eine Entscheidung, die den Arbeitsbereich des Klägers betraf, an sich ziehen konnte.
Das arbeitsteilige Zusammenwirken der Ärzte in einem Krankenhaus habe – wie auch andere vergleichbare Entscheidungs- und Handlungsprozesse im Wirtschaftsleben – gerade zur Voraussetzung, dass der jeweilige Chefarzt nicht alle im Zuge der Behandlung der vielen zu betreuenden Patienten anfallenden medizinischen Detailentscheidungen persönlich treffen könne. Das Weisungsrecht bestehe aber dennoch.
Fachwissen kein Abgrenzungskriterium
Der Kläger verfüge als Facharzt für Innere Medizin, Kardiologe, über spezielle Fachkenntnisse, die Grundlage für die Beauftragung mit dem Dienst im Bereich der kardiologischen Funktionsdiagnostik war. Vielfach sei Grundlage für die Einstellung in vielen klassischen Arbeitsverhältnissen, dass Arbeitnehmer über spezifische Fachkenntnisse verfügten. Auch Chefärzte in Kliniken würden regelmäßig abhängig beschäftigt, wenngleich Grundlage ihrer Berufung im Allgemeinen herausragende Fachkenntnisse seien. Eigenverantwortlichkeit und inhaltliche Freiheiten bei der Aufgabenerfüllung bildeten erst dann ein aussagekräftiges Indiz für Selbstständigkeit, wenn sie nicht mehr innerhalb des Rahmens dienender Teilhabe am Arbeitsprozess zu verorten seien, sondern eigennützig durch den Auftragnehmer zur Steigerung seiner Verdienstchancen eingesetzt werden könnten. Entsprechende Möglichkeiten zur Steigerung seiner Verdienstchancen seien dem Kläger jedoch gerade nicht eröffnet worden. Für seine Arbeitszeit war ihm der vereinbarte Stundenlohn von 90 € gewiss, er habe indes keine Möglichkeit gehabt, diesen Verdienst durch Ausnutzung unternehmerischer Freiräume zu erhöhen.
Kein unternehmerisches Risiko
Ebenso wenig habe der Kläger ein unternehmerisches Risiko getragen. Maßgebendes Kriterium für ein solches Risiko sei nach den vom BSG entwickelten Grundsätzen, ob eigenes Kapital oder die eigene Arbeitskraft auch mit der Gefahr des Verlusts eingesetzt werde, der Erfolg des Einsatzes der sächlichen oder persönlichen Mittel also ungewiss sei. Ein solches Risiko sei allerdings nur dann Hinweis auf selbstständige Tätigkeit, wenn diesem Risiko auch größere Freiheiten in der Gestaltung und der Bestimmung des Umfangs beim Einsatz der eigenen Arbeitskraft oder größere Verdienstchancen gegenüberstehen. Aus dem (allgemeinen) Risiko, außerhalb der Erledigung einzelner Aufträge zeitweise die eigene Arbeitskraft ggf. nicht verwerten zu können, folge hingegen kein Unternehmerrisiko bezüglich der einzelnen tatsächlich erbrachten Einsätze.
Im vorliegenden Fall habe der Kläger die eigene Arbeitskraft daher gerade nicht mit der Gefahr des Verlusts eingesetzt. Für die von ihm erbrachten Arbeitsleistungen sei ihm vielmehr nach den getroffenen Vereinbarungen der vorgesehene Stundenlohn von 90 € gewiss gewesen. Er musste nicht in einem relevanten Umfang eigenes Kapital einsetzen. Soweit er eigene Berufskleidung, ein eigenes Namensschild sowie eigenes Stethoskop eingesetzt habe, begründete dies schon deshalb kein spezifisches Unternehmerrisiko, weil bei wirtschaftlicher Betrachtung der damit verbundene Wert im Verhältnis zu den von der Beklagten zur Verfügung gestellten Geräten und Arbeitsmitteln nicht ins Gewicht falle. Darüber hinaus hätten viele Beschäftigte bereits höhere Aufwendungen für die bei der Berufsausübung zu tragende Bekleidung, insbesondere falls der Arbeitgeber Wert auf ein gediegenes Erscheinungsbild der Mitarbeiter lege.
Keine Dispositionsfreiheit in Fragen der Sozialversicherung
Eine eigene Betriebsstätte und/oder ein eigenständiger Marktauftritt des Klägers seien nicht erkennbar. Der Ausstellung von Rechnungen komme in diesem Zusammenhang keine ins Gewicht fallende eigenständige Aussagekraft zu. Es sei zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die Sozialversicherungspflicht von abhängig Beschäftigten als Pflichtversicherung ausgestaltet habe. Diese stehe als solche nicht zur freien Disposition der Beteiligten. Dementsprechend sei die Abgrenzung nach inhaltlichen Kriterien vorzunehmen. Nach der Rechtsprechung des BSG komme einem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien, keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begründen zu wollen, lediglich dann Bedeutung zu, wenn dieser Wille durch weitere Aspekte gestützt werde, also die übrigen Umstände gleichermaßen für Selbstständigkeit sprächen.
Im vorliegenden Zusammenhang sprächen die sonstigen Umstände, insbesondere die Vereinbarung eines Zeitlohns, das Fehlen eines unternehmerischen Risikos sowie die dargelegte Eingliederung des Klägers in die arbeitsteilige Betriebsorganisation der Beigeladenen nachdrücklich für die Annahme einer abhängigen Beschäftigung. Entsprechend ließen Abreden, die darauf gerichtet sind, an den Arbeitnehmer- bzw. Beschäftigtenstatus anknüpfende arbeits-, steuer- und sozialrechtliche Regelungen abzubedingen bzw. zu vermeiden (z.B. Nichtgewährung von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaub bzw. Urlaubsgeld; Verpflichtung, Einnahmen selbst zu versteuern; Obliegenheit, für mehrere Auftraggeber tätig zu werden oder für eine Sozial- und Krankenversicherung selbst zu sorgen), selbst bei tatsächlicher Umsetzung in der Praxis nur Rückschlüsse auf den subjektiven Willen der Vertragsparteien zu.
Schließlich gäbe auch die vereinbarte Entgelthöhe keinen Anlass zur Annahme, der Kläger habe seine Tätigkeit nicht im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung verrichtet. Bei der Honorarhöhe handele es sich gleichfalls nur um einen bei der Gesamtwürdigung zu berücksichtigenden Anhaltspunkt, weshalb weder aus der Vergleichbarkeit der zu betrachteten Tätigkeiten noch aus dem Vergleich der hieraus jeweils erzielten Entgelte bzw. Honorare überspannte Rückschlüsse gezogen werden dürften. Der Auftraggeber könne sich nicht durch die Vereinbarung eines Zuschlags zum üblichen Stundenlohn eines vergleichbaren abhängig Beschäftigten von der Pflicht zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen freikaufen.
Dies sei auch nicht mit Zustimmung der betroffenen Arbeitskraft möglich. Die gesetzlich vorgeschriebene Begründung einer gesetzlichen Pflichtversicherung erfolge gerade vor dem Hintergrund, dass erst die Pflicht zur Abführung entsprechender Beiträge ihre tatsächliche Abführung sicherzustellen vermöge. Anderenfalls würden nicht wenige Betroffene im Interesse eines tendenziell kurzfristigen finanziellen Vorteils in Form der Beitragseinsparung die langfristig im eigenen Interesse liegende soziale Absicherung (nicht selten auch vor dem Hintergrund eines für den Notfall erwarteten Einspringens der Sozialhilfeträger) vernachlässigen.
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.