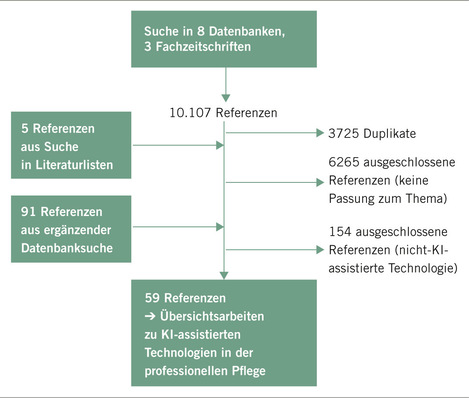Sachverhalt
Laut D-Arzt-Bericht nahm der 49-jährige Kläger als Fahrdienstleiter am 25. November 2011 gegen 10:35 Uhr einen Beinahe-Pkw-Zug-Unfall wahr. Da er entsprechendes nicht das erste Mal erlebte, habe ihn das Ereignis überfordert und innerlich beunruhigt. Seitens des Städtischen Klinikums wurde der Verdacht einer traumatischen Belastungsstörung (PTBS) geäußert. Im Nachschaubericht hielt die D-Ärztin fortbestehende innere Unruhe („Stehe wie neben mir“) sowie Schlafstörungen fest. Eine psychologische/psychotherapeutische Mitbehandlung sei dringend erforderlich. Arbeitsunfähigkeit des Klägers liege voraussichtlich bis zum 9. Dezember 2011 vor. Auf telefonische Nachfrage der Beklagten teilte die Ärztin ergänzend mit, es habe am 25. November 2011 keine Verletzten gegeben, da der Pkw in der Schranke hängen geblieben und der Fahrer ausgestiegen sei. Im März 2003 habe sich ein ähnliches Ereignis zugetragen, als ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen und ein Toter zu beklagen gewesen sei.
Nach der betrieblichen Unfallanzeige wurde der Kläger durch das Ereignis vom 25. November 2011 an die Vorfälle vom 6. März 2003 (tödlicher Bahnunfall) sowie vom 23. September 2009 (Fastzusammenstoß zweier Züge) erinnert. Beim Ereignis im März 2003 sei er selbst nicht zugegen gewesen, habe jedoch seine Frau abgelöst, die ebenfalls als Fahrdienstleiterin beschäftigt ist. Im September 2009 habe er als Fahrdienstleiter den Zusammenstoß zweier Züge verhindert. Laut Vermerk der Beklagten hatte der Kläger telefonisch mitgeteilt, er habe aus dem Flachstellwerk die Durchfahrt des Zuges gestellt und die Schranke geschlossen. Dann habe er gesehen, wie ein Auto unter der Schrankenanlage geklemmt habe. Der Zug sei dann vorsichtig am Auto vorbei gefahren, so dass nur am Auto und der Schranke eine leichte Beschädigung aufgetreten sei. Der Fahrer des Pkw sei schon vorher ausgestiegen.
Mit Bescheid vom 2. Dezember 2011 und Widerspruchbescheid vom 26. März 2012 lehnte die Beklagte die Anerkennung des Geschehens als Arbeitsunfall ab, da ein eigentliches Unfallereignis im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung als Ursache eines psychischen Gesundheitsschadens nicht stattgefunden habe. Der Kläger selbst habe sich zu keinem Zeitpunkt in einer lebensbedrohlichen Situation befunden. Allein die Vorstellung eines Unfallereignisses sei für das Vorliegen eines erforderlichen äußeren Ereignisses unzureichend. Es habe sich vielmehr um eine berufstypische Belastung gehandelt. Der betroffene Pkw habe objektiv nicht auf den Schienen gestanden. Die gesamte Gefahrensituation habe mithin nur der Vorstellung des Klägers entstammt und sei auf dessen Überängstlichkeit im Sinne einer inneren Unruhe zurückzuführen. Der Kläger sei – im Unterschied zu den vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen S-Bahnfahrerfällen – nicht direkt in den Beinahe-Unfall verwickelt, sondern lediglich Dritter gewesen, der das Geschehen beobachtet habe.
Im Widerspruchverfahren und in der nachfolgenden Klage vor dem Sozialgericht Magdeburg betonte der Kläger, er habe aus seiner Perspektive nicht erkennen können, dass der Pkw unter der Schranke geklemmt und der Fahrer das Auto vor der Zugdurchfahrt verlassen habe. Vielmehr sei er von einem sich in Richtung Gleisanlage bewegenden Objekt und einer sicheren Kollision zwischen Zug und Pkw ausgegangen. Durch das Ereignis sei eine psychische Gesundheitsstörung verursacht worden, die nicht als typische berufliche Belastung bezeichnet werden könne. Vielmehr habe es für ihn eine extreme Ausnahmesituation dargestellt, die ihn in einen Schockzustand versetzt und die zwei früheren Erlebnisse wieder hervorgerufen habe.
Mit Gerichtsbescheid vom 20. Oktober 2014 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen und ausgeführt: Der Kläger habe keinen Anspruch auf die Feststellung von Unfallfolgen, da das Ereignis vom 25. November 2011 keine Gesundheitsstörung wesentlich verursacht habe. Es seien keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Geschehen vom 25. November 2011, bei dem der Kläger selbst keiner Lebensgefahr ausgesetzt gewesen sei, eine außergewöhnliche Bedrohung katastrophalen Ausmaßes dargestellt habe, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung habe hervorrufen können.
Gegen den Gerichtsbescheid hat der Kläger Berufung beim Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (LSG) eingelegt und hervorgehoben, dass aus seiner damaligen Sicht keine fahrdienstlichen Maßnahmen mehr existiert hätten, um die als sicher vorhergesehene Kollision zu unterbinden. Zusammengekauert habe er auf den Knall des Zusammenpralls gewartet, zu dem es jedoch nicht gekommen sei. Vielmehr habe der Zug wie gewöhnlich gebremst und am Bahnsteig gehalten, da sich die Schranke in den Scharnieren der Heckklappe des Pkw „festgebissen“ habe. Der Zusammenprall sei nur deshalb ausgeblieben, weil der Pkw es nicht durch die Schranke geschafft habe. Ein Bedienen der Schrankenanlage sei nicht möglich gewesen; die Schranke habe mit Hilfe mehrerer Anwesender manuell hochgedrückt werden müssen.
Der Senat hat vom Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Dr. B ein Gutachten eingeholt. Der Sachverständige diagnostizierte eine mittelgradige psychosomatische Störung im Sinne einer Mischung der Diagnosen F45.1 (somatische Belastungsstörung), F34.1 (Dysthymie), F44 (Konversionsstörung) und F41.9 (nicht näher bezeichnete Angststörung) die er im Ergebnis bis zum 9. Dezember 2011 als unfallbedingt beurteilte. Seit dem 10. Dezember 2011 komme dem Ereignis vom 25. November 2011 dagegen keine wesentliche ursächliche Bedeutung mehr zu. Es sei ab da nur noch Anknüpfungspunkt der bestehenden neurotischen Störung des Klägers. Das Geschehen vom 25. November 2011 sei grundsätzlich geeignet gewesen, mehr oder weniger ausgeprägte seelische Beschwerden zu verursachen. Es habe sich bei ihm jedoch um keinen Vorgang außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes gehandelt, der bei fast jedem Angst, Schrecken und Hilflosigkeit habe hervorrufen können. Insoweit fehle es an der Eingangsvoraussetzung einer PTBS.
Äußeres Ereignis versus innerer Ursache
Mit seinem Urteil hat das LSG den Bescheid und Widerspruchsbescheid der Beklagten aufgehoben und das Ereignis vom 25. November 2011 als Arbeitsunfall anerkannt. Es sah sämtliche Voraussetzungen des Unfallbegriffs als erfüllt. Insbesondere stellte das Geschehen vom 25. November 2011 nach Auffassung des Senats ein „von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis“ im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII dar.
Zwar habe das BSG in der Entscheidung vom 20. November 2011 (B 2 U 23/10 R) angedeutet, dass bei einer nur „eingebildeten“ Gefahr infolge (innerer) „Überängstlichkeit“ des Versicherten Zweifel am Unfallbegriff bestehen könnten. Mit dessen Legaldefinition in § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII solle nach dem ausdrücklich erklärten gesetzgeberischen Willen nur die in der Rechtsprechung etablierte Begrifflichkeit übernommen werden.
Für diese sei aber seit Jahrzehnten geklärt, dass das Erfordernis der äußeren Einwirkung lediglich der Abgrenzung gegenüber Gesundheitsbeeinträchtigungen aus inneren Ursachen bzw. infolge Selbstschädigungen dient. Hieran habe die Rechtsprechung stets festgehalten und betont, dass für das Vorliegen eines Unfalls noch nicht einmal ein äußerliches, mit den Augen zu sehendes oder gar besonderes, ungewöhnliches Geschehen erforderlich ist. Vielmehr seien alle Hergänge geschützt, die in einem inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit ablaufen. Letzteres sei vorliegend unstreitig.
Keine Differenzierung nach Üblichkeit des Geschehens
Eine Differenzierung in nicht versicherte „übliche“ und versicherte „unübliche“ Geschehnisse sei weder dem Wortlaut noch dem Regelungszweck des § 8 Abs. 1 SGB VII zu entnehmen. Entscheidend für den Unfallbegriff seien demnach ein versichertes („äußeres“) Ereignis als Ursache und ein Gesundheits(erst)schaden als Wirkung. Dabei könne der Gesundheitserstschaden nach einhelliger Ansicht in Rechtsprechung und im Schrifttum sowohl durch eine äußere physische Einwirkung (z.B. Verletzung beim Aufschlagen des Körpers auf den Boden nach Sturz) als auch durch äußere psychische Belastungen verursacht werden.
Gemessen daran beinhalte das Geschehen vom 25. November 2011 jedenfalls keinen betrieblichen Vorgang, der sich nicht von den üblichen Routinegeschäften eines Fahrdienstleiters abhob. Die äußere betriebsbedingte Einwirkung auf die Psyche des Klägers läge bereits darin, dass aus seiner Position keine fahrdienstlichen Maßnahmen mehr existierten, um die als sicher vorhergesehene Kollision zwischen dem herannahenden Zug und dem – letztlich unter der Schranke stecken gebliebenen – Pkw zu unterbinden. Dem läge mit der eingetretenen Beschädigung der Schrankenanlage und des Pkw auch ein tatsächlich nachweisbarer, äußerer betriebsbezogener Unfallvorgang zugrunde und keine Vorstellung allein in der Phantasie des Klägers infolge „Überempfindlichkeit“.
Ex-post-Betrachtung nicht maßgeblich
Hieran ändere auch der Umstand nichts, dass sich das Flachstellwerk nach dem Vorbringen der Beklagten 80 m vom Gleis entfernt befindet und der Abstand zwischen der Schranke sowie dem ersten Gleis 6 m beträgt. Denn dass der lediglich im Bereich der Heckklappe unter den Schrankenanbauten eingeklemmte Pkw den Gleiskörper wegen des bereits ausgestiegenen Fahrzeugführers objektiv nicht mehr erreichen konnte, war dem Kläger zwar im Nachhinein, nicht aber während des maßgeblichen Geschehens bewusst.
Im Übrigen seien Sachverhalte, in denen ein Versicherter bei Ex-post-Betrachtung objektiv keiner (körperlichen) Gefahr ausgesetzt war (z.B. Bedrohung mit einer – allenfalls bei näherer Inspektion als solche erkennbaren – Spielzeug-/Schreckschusspistole im Rahmen eines Banküberfalls), gerade nicht von vornherein dem Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversicherung entzogen. Im Gegenteil könne ein versichertes psychisches Trauma insbesondere auch dann vorliegen, wenn betriebsbedingte äußere Umstände beim Versicherten die nachvollziehbare Vorstellung bewirkten, sich in einer gefährlichen Situation zu befinden, so dass insbesondere Schockreaktionen vom Unfallversicherungsschutz erfasst sind.
Keine objektive Gefahrenlage erforderlich
Dies gelte umso mehr, als nicht jede als traumatisch (mit-)bedingt in Betracht kommende psychische Gesundheitsstörung der ICD-10 eine (weitergehende) objektive Gefahrenlage für den Betroffenen voraussetzt. Es komme daher nicht darauf an, ob der hinter seinem Schreibtisch Schutz suchende Kläger überhaupt von umherfliegenden Teilen hätte in Mitleidenschaft gezogen werden können. Beim Kläger sei auf Grundlage des gerichtlichen Sachverständigengutachtens auch eine psychosomatische Gesundheitsstörung gesichert, die nach den überzeugenden Darlegungen von Dr. B. – zumindest bis zum 9. Dezember 2011 – mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als im Wesentlichen (mit)ursächlich auf das Ereignis vom 25. November 2011 zurückzuführen sei.
Individueller Prüfmaßstab
Erst wenn feststehe, dass ein bestimmtes Ereignis eine naturwissenschaftliche Ursache für einen Erfolg ist, stelle sich in einem zweiten Schritt die Frage nach einer wesentlichen Verursachung des Erfolgs durch das Ereignis. Diese Grundsätze gelten in Bezug auf alle als Gesundheitserstschäden geltend gemachten Erkrankungen und damit auch für psychische Störungen. Insoweit dürfe gerade nicht von vornherein darauf abgestellt werden, wie ein „normaler“ Versicherter reagiert hätte.
Ebenso wie bei körperlichen Auswirkungen eines Unfalles sei auch bei Vorgängen im Bereich der Psyche nicht unter Anlegung eines generalisierenden Maßstabs darauf abzustellen, ob die Auswirkungen des Unfalls auch bei einem durchschnittlichen Menschen erfahrungsgemäß gleiche oder ähnliche Folgen gehabt hätten. Vielmehr sei maßgeblich, welche Auswirkungen der Unfall, d. h. dessen psychische Belastung, gerade beim betroffenen Versicherten infolge der Eigenart seiner Persönlichkeit gehabt habe.
Ausgehend hiervon sei das Geschehen vom 25. November 2011 zunächst als naturwissenschaftliche Bedingung der psychosomatischen Störung des Klägers wirksam geworden, da es ohne gleichzeitiges Entfallen der bei ihm aufgetretenen psychischen Beschwerden nicht hinweggedacht werden könne. Dies habe Dr. B. ausdrücklich festgestellt und überzeugend damit begründet, dass das Unfallereignis nach aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet gewesen ist, beim Kläger ein psychisches Trauma zu verursachen.
Daneben werde die Kausalbeziehung zwischen dem Ereignis und der psychosomatischen Störung des Klägers durch den zeitlichen Zusammenhang und dessen Verhalten wahrscheinlich gemacht. So seien beim Kläger sofort am Morgen nach dem Ereignis vom 25. November 2011 innere Unruhe, ein Kribbelgefühl unter der Haut, ein Zucken des linken Auges, ein Zittern des gesamten Körpers sowie ein verminderter Antrieb und ein erhöhtes Schlafbedürfnis aufgetreten. Unmittelbar am Folgetag habe der Kläger dann den D-ärztlichen Notdienst des Städtischen Klinikums D. aufgesucht, um dort eine Überforderung und innere Beunruhigung durch das zwei Tage zurückliegende Ereignis zu schildern.
Umgekehrt lägen keine belastbaren Anknüpfungstatsachen dafür vor, dass das Ereignis vom 25. November 2011 zur Verursachung einer psychosomatischen Störung naturwissenschaftlich nicht geeignet war oder dieses als rechtlich unwesentliche, so genannte Gelegenheitsursache anzusehen sei. Denn beim Kläger seien auf psychischem Gebiet keine derart überragende Schadensanlage vollbeweislich gesichert, die den Schluss zuließe, die psychosomatische Störung hätte durch jedes Alltagsereignis ausgelöst werden könnten.
Die Revision wurde zuzulassen, weil der Senat die Voraussetzungen der Feststellung eines Ereignisses als Arbeitsunfall bei (allein) psychischen Einwirkungen im Sinne von § 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG für noch nicht abschließend geklärt hielt.
Interessenkonflikt. Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.