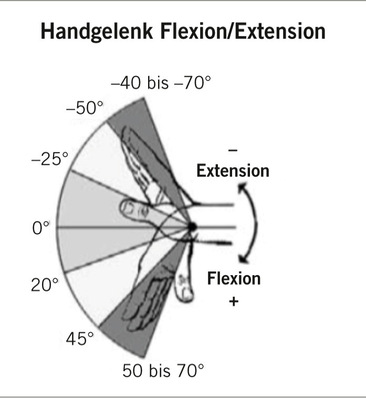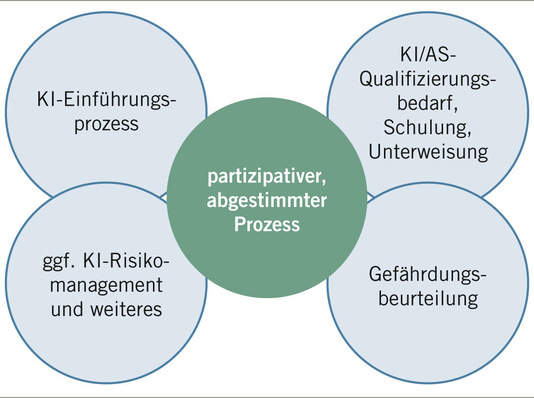Im Jahr 2015 befanden sich fast 60 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Gewalt und Folter weltweit auf der Flucht (UNHCR 2015), in Deutschland wurden über 400 000 Asylanträge gestellt. Auch wenn inzwischen die Zahl der nach Deutschland geflüchteten Menschen deutlich gesunken ist, ist der Bedarf nach psychosozialer Versorgung weiterhin hoch und für eine gelingende Integration von größter Bedeutung. Auf Einladung der Landesärztekammer Baden-Württemberg, in Person ihres Präsidenten Ulrich Clever, und der Ständigen Konferenz Ärztlicher Psychotherapeutischer Verbände (StäKo) diskutierten deshalb verschiedene in der psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen tätige Experten am 9. Juli 2016 in Berlin, wie sich die Möglichkeiten und Grenzen der Versorgung traumatisierter Flüchtlinge derzeit in Deutschland darstellen und welche Rolle die Psychosoziale Medizin in einem funktionstüchtigen, multiprofessionellen Versorgungsnetz übernehmen kann, um praktikable sektorenübergreifende Lösungsansätze vorzuhalten und weiter auszubauen, die der Vielschichtigkeit der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen gerecht werden.
Die Situation der Flüchtlinge und Asylsuchenden sowie ihrer Helfer
Flüchtlinge sind gewöhnlich über einen langen Zeitverlauf erheblichen Stressoren ausgesetzt. Sie beginnen während Bürgerkriegshandlungen im Heimatland, setzen sich fort auf monate- bis jahrelanger gefährlicher und erschöpfender Flucht und nehmen im Aufnahmeland kein Ende. Hier sind Flüchtlinge konfrontiert mit der Trennung von engen Bezugspersonen, weiterhin eintreffenden schlechten Nachrichten aus der Heimat, Unterbringung und z. T. auch Gewalterfahrungen in Massengemeinschaftsunterkünften, fremdenfeindlichen Übergriffen, bürokratischen Abläufen in einem langen Asylverfahren bei hoher Ungewissheit über seinen Ausgang und schließlich all den Herausforderungen und dem Leistungsdruck, die die neue Kultur mit ihrer fremden Sprache, den ihnen unbekannten gesellschaftlichen Normsetzungen und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektive mit sich bringt.
Neben dem Schicksal der Flüchtlinge sollte der Blick auch auf die Helfer gerichtet werden, die aus verschiedenen Berufsgruppen (u. a. Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Übersetzer, Anwälte, Wachpersonal) kommend sich an der psychosozialen Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen beteiligen sowie auf die unzähligen, hoch engagierten ehrenamtlichen Helfer, die bei der schrittweisen Integration Unterstützung leisten. Sie sind erheblich gefährdet, selbst eine posttraumatische Störung, eine sog. sekundäre Traumatisierung zu entwickeln.
Der rechtliche Rahmen für psychotherapeutische Behandlungen
Nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) haben Flüchtlinge Anspruch auf eine medizinische Notversorgung, d. h. auf das, was „im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten ist“. Alle darüber hinausgehenden Leistungen, so auch Psychotherapie, kann vom zuständigen Sozialamt nach dem AsylbLG § 6 genehmigt werden, wenn sie „im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind“. Die Leistungsberechtigten nach AsylbLG stehen vor der Herausforderung, gegenüber dem Sozialamt glaubhaft zu machen, dass ihre psychische Erkrankung entweder akut oder dass eine Psychotherapie zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich ist. Dabei ist insbesondere die Abgrenzung chronischer und akuter Erkrankungen sehr umstritten, da bei Nichtbehandlung chronischer Krankheiten ein akuter Krankheitszustand droht. Asylsuchende, die ohne wesentliche Unterbrechung länger als 15 Monate in Deutschland leben, haben nach § 264 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Sat 1 SGB V Anspruch auf das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Sie werden ab diesem Zeitpunkt wie Empfänger von Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) behandelt. Damit haben psychisch erkrankte Flüchtlinge in der Regel nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland auch regulär Anspruch auf eine psychotherapeutische Behandlung.
Zur Epidemiologie von Traumafolgestörungen unter Flüchtlingen und Asylbewerbern
Epidemiologische Anhaltzahlen zur Häufigkeit und Zahl psychischer Störungen bei Asylbewerbern bietet ein Projekt, das unter Leitung des Chefarztes der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Nürnberg, Günter Niklewski, zwischen 2011 und 2012 300 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in einer Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Bayern (Zirndorf) systematisch untersuchte. Diese hatten eine Gutachterstelle entweder aus eigener Initiative aufgesucht oder waren per Zufallsprinzip ausgewählt worden. Die Asylbewerber der Zufallsstichprobe stammten u. a. aus dem Iran (ca. 39 %), dem Irak (ca. 23 %) und Afghanistan (ca. 15 %). Rund zwei Drittel aller untersuchten Probanden hatte eine psychiatrische Diagnose; selbst in der Zufallsstichprobe lag die Zahl der Menschen, die die Kriterien einer psychischen Störung erfüllten, bei 45 % (gegenüber einer 12-Monats-Prävalenz von knapp 3 % in der Allgemeinbevölkerung). Von den 180 Probanden mit einer psychiatrischen Diagnose hatten 61 Probanden eine affektive Störung und 55 Probanden eine posttraumatische Belastungsstörung als Erstdiagnose. Insomnie (chronische Ein- und Durchschlafstörung) war die dritthäufigste Diagnose in dem gesamten Probandengut; daneben waren auch Angststörungen nicht selten. Auch gab es nicht selten Situationen mit akutem Handlungsbedarf, wie z. B. schwere dissoziative Zustände, psychogene Kollapszustände oder Zustände aggressiver Gereiztheit. In der derzeitigen Flüchtlingswelle sind zudem suchtassoziierte Störungen gehäuft zu beobachten, die – im Falle der Benzodiazepinabhängigkeit – ihren Ausganspunkt z. T. schon im Heimatland, oft aber erst auf der Flucht im Sinne der Selbstmedikation oder auch der ärztlichen Verschreibung nehmen.
Dieser hohe Hilfebedarf steht einer praktizierten Versorgungssituation bei der Erstinaugenscheinnahme gegenüber, die auf somatisch-medizinische Zielsymptome fokussiert und deren primäre Begrenzung auf Akut- und Notfallsituationen Gefahr läuft, einer zu späten Behandlung und Chronifizierung von traumaassoziierten Störungen Vorschub zu leisten und einem Präventionsgedanken nicht gerecht zu werden.
Die besondere Situation minderjähriger Flüchtlinge
Eine besondere Risikogruppe bei den Geflüchteten stellen Kinder und Jugendliche dar. Die Versorgung dieser besonders bedürftigen Gruppe hat sich eine Sozialpsychiatrische Flüchtlingsambulanz in Würzburg zur Aufgabe gemacht. Hierüber berichtete bei dem Symposium Dominique Schmitt, der als Psychologischer Psychotherapeut in einer Würzburger kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis an der Erbringung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen bei minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung beteiligt ist. Er zeigte auf, dass die Diagnostik viel Zeit (zwischen 4,5 und bis zu 8,5 Std. pro Flüchtling) erfordert und u. a. neben einem ausführlichen Anamnesegespräch im Beisein eines Sprachmittlers der Einschluss einer ausführlichen körperlichen und auch testpsychologischen Untersuchung benötigt wird.
Notwendige Voraussetzung für eine gelingende Integration ist eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen, aber auch mit engagierten Bürgern, die z. B. über Patenschaften für unbegleitete Minderjährige nachhaltige Hilfe anbieten. Während die bei Ankunft unter 16-Jährigen nach Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Anspruch darauf haben, dass sich das Jugendamt um ihre Unterbringung und alle weiteren Schritte kümmert, stellt das abrupte Ende von Förderungsleistungen nach dem KJHG mit Erreichen des 18. Geburtstages ein besonderes Problem dar, so berichtete Schmitt.
Das besondere Schicksal auf der Flucht befindlicher Frauen
Jan Ilhan Kizilhan, Leiter des Studiengangs Psychische Erkrankungen und Sucht an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, berichtete über das Projekt „Sonderkontingent Nordirak Baden-Württemberg“, das eine psychosoziale Versorgung für 1100 vorwiegend jesidische (êzîdîsche) junge Frauen, die vom sog. „Islamischen Staat“ verschleppt, missbraucht und gefoltert wurden, anbietet. Eindrucksvoll zeichnete er ihr Schicksal mit Versklavung in der ganzen arabischen Welt auf, aber auch allgemeiner das von Frauen, die in gewaltsam unterdrückenden patriarchalischen Gesellschaften aufwachsen. Sie seien, so Kizilhan, im Ausdruck ihres psychischen Leidens auf Regression und Körpersprache beschränkt, weshalb dieses in vielfältigen kulturspezifischen, vorwiegend somatischen und für bestimmte Regionen typischen Syndromen in Erscheinung tritt.
Kompensationsmöglichkeiten für diese Frauen stehen im Zusammenhang mit individuellen und kollektiven Bewältigungsstrategien, an denen Großfamilien, Dorf- und Stammesgemeinschaften beteiligt sind, die direkt oder auf dem Wege des kollektiven Gedächtnisses auf Normverletzungen aufmerksam machen. Die Gemeinschaft, vor allem deren Mitglieder in Führungspositionen, können adaptiv Selbstregulationssysteme mit kulturell vorgegebenen Verhaltensprogrammen aktivieren. Werden solche kulturellen Kompensationen nicht angeboten oder scheitern sie, droht der Zusammenbruch des Selbstregulationssystems mit der Folge einer psychopathologischen Symptomatik, vor allem in Form von Somatisierungsstörungen, Zwangshandlungen, Depressivität oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung.
Herausforderungen an die Sprachmittler und Dolmetscher
Ferdinand Haenel, Leiter der Tagesklinik des Berliner Behandlungszentrums für Folteropfer und Herausgeber eines Standardwerkes zur Begutachtung in aufenthaltsrechtlichen Fragen, berichtete über die Besonderheiten in der Exploration von Traumaopfern und der zentralen Rolle von Sprachmittlern darin. Wichtige Voraussetzungen sind Sprachsicherheit und eine möglichst wortgetreue Übersetzung des Dolmetschers. Der Übersetzer sei keine „Übersetzungsmaschine“ sondern trete in eine Triade mit Patient und Therapeut ein.
Anhand von verschiedenen Kasuistiken wurde deutlich, welchen Belastungen Sprachmittler ausgesetzt sind und wie sie selbst Opfer einer sekundären Traumatisierung werden können. Deshalb, so schlussfolgerte Haenel, brauche es neben Fortbildungen regelmäßige Entlastungs- und Informationsgespräche zwischen Dolmetscher und Therapeuten vor und nach den Behandlungsstunden und auch die Möglichkeit einer externen Supervision. Schließlich seien nicht nur Therapeuten, sondern auch Sprachmittler gefordert, das Abstinenzgebot einzuhalten.
Welche Therapieangebote werden gebraucht?
Ljiljana Joksimovic, leitende Oberärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, referierte über die notwendigen Modifikationen der Psychotherapie bei traumatisierten Flüchtlingen. In der von ihr geleiteten transkulturellen Ambulanz werden seit nahezu 20 Jahren traumatisierte Kriegsflüchtlinge kultursensibel und traumaorientiert psychotherapeutisch behandelt. Sie wies darauf hin, dass ein großer Anteil der Flüchtlinge mit Traumafolgestörungen nicht nur unter den Symptomen einer einfachen Posttraumatischen Belastungsstörung leidet, sondern vielfach unter komplexen Traumafolgestörungen, insbesondere auch unter somatoformen Schmerzstörungen.
Die Psychotherapie dieser Patienten muss einerseits kultursensibel die subjektiven Krankheits- und Therapievorstellungen der jeweiligen Flüchtlinge integrieren. Sie hat die aktuelle soziale und rechtliche Situation der Flüchtlinge, insbesondere die Wohn- und Arbeitssituation, aber auch die juristischen und aufenthaltsrechtlichen Fragen zu berücksichtigen. Initial ist der Aufbau einer therapeutischen Beziehung in diesen Behandlungen häufig durch das sich in der Folge der schwersten Traumatisierungen entwickelnde Misstrauen sehr erschwert. Hier bedarf es einer sehr aktiven Technik zum Beziehungsaufbau, die den Patienten in seinen Kompetenzen fordert.
Im Zentrum der psychotherapeutischen Intervention stehen zunächst psychoedukative und stabilisierende Interventionen im Vordergrund. Diese ermöglichen es den Flüchtlingen, sowohl mit den „Flashbacks“ als auch mit den Symptomen der Übererregung besser umzugehen. Der Einsatz traumakonfrontativer Techniken setzt hingegen die Entwicklung einer stabilen Arbeitsbeziehung ebenso voraus wie die Fähigkeit zur Selbstregulation.
Die Effekte dieser psychotherapeutischen Intervention wurden im Rahmen einer Studie nachgewiesen. Die Studie belegt, dass traumazentrierte psychotherapeutische Interventionen bei Kriegsflüchtlingen die Symptomatik der Posttraumatischen Belastungsstörung aber auch der somatoformen Störung deutlich reduzieren können. Sie können einen Beitrag leisten, psychosoziale Integrationshindernisse zu reduzieren.
„Traumainformierte Peer-Berater“ – Laienhelfer
In ihrem Beitrag zu den „traumainformierten Peer-Beratern“ in der Versorgung von Flüchtlingen stellte Andrea Möllering, Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische Medizin am Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld und psychotherapeutische Leiterin des Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge in Bielefeld, ein Versorgungskonzept vor, in dem Flüchtlinge selbst geschult werden, traumatisierte Flüchtlinge aus ihrem Kulturraum hilfreich zu unterstützen. Ausgangspunkt des Konzepts sind Beobachtungen, dass nur ein Teil der Flüchtlinge mit Traumafolgestörungen einer intensiven traumaorientierten Psychotherapie durch erfahrene Psychotherapeuten bedarf oder diese akzeptiert. Eine zweite Gruppe profitiert vor allem von günstigen Umfeldbedingungen sowie von basalen stabilisierenden und ressourcenorientierten Maßnahmen. Die geschulten Peer-Berater sollen durch eine entsprechende Ausbildung in die Lage versetzt werden, eine positive und haltgebende Beziehung zu den Flüchtlingen mit Traumafolgestörungen aufzubauen, sie psychoedukativ über den Umgang mit Traumafolgesymptomen zu informieren und sie zu basalen stabilisierenden Maßnahmen anzuleiten.
Gleichzeitig könnten traumainformierte Laienhelfer eine Funktion bei der Identifikation und Weitervermittlung derjenigen Flüchtlinge wahrnehmen, die einer traumaspezifischen Psychotherapie im engeren Sinne oder einer psychiatrischen Behandlung bedürfen. So ließe sich einerseits eine basale niederschwellige Beratung mit einer Reduktion der Behandlungsbarrieren für eine psychotherapeutische Intervention verbinden. Ein entsprechendes Schulungsprogramm für traumainformierte Peer-Berater wurde entwickelt und wird zurzeit in NRW aufgebaut.
Der Beitrag der Psychosozialen Medizin und Psychotherapie in der Flüchtlingsversorgung und gesellschaftliche Aufgaben
Schlussfolgernd, so legen die Beiträge des Symposiums nahe, brauchen traumatisierte Flüchtlinge eine umfassende psychosoziale Versorgung, die in ihren Schwerpunkten in Abhängigkeit von der aktuellen Lebenssituation, der Verweildauer im Aufnahmeland und der Schwere der psychopathologischen Symptomatik interindividuell unterschiedlich ist. Zu beachten sind auch je nach kulturellem Hintergrund bestehende Unterschiede in den Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit und daraus resultierenden unterschiedlichen Ursachenzuschreibungen, sowie Erwartungen an Behandlungsmethoden und schließlich Vorstellungen von Heilungsprozessen. Es ist eine frühzeitige Erkennung vulnerabler Flüchtlinge vor Ort in den Erstaufnahmeeinrichtungen erforderlich, um wirksame Präventionsmaßnahmen einleiten und eine Chronifizierung bereits vorhandener Symptome verhindern zu können. Dies gelingt am besten durch ein multiprofessionelles Team aus u.a. Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern und Pflegenden, das auch engagierte Laienhelfer einschließen sollte.
Aktuell erhält jedoch nur ein geringer Teil der Flüchtlinge, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, eine angemessene Behandlung und noch weniger sind präventive Maßnahmen verbreitet. Es fehlen insbesondere muttersprachliche, niederschwellige (Kurz-)Interventionen, die zum Ziel haben, neben einer Minderung der Symptomlast die selbstständige Alltagsbewältigung und soziale Kompetenz zu erhöhen, um hiermit die Voraussetzungen für eine ausreichende persönliche Belastungsfähigkeit im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit zu schaffen. Eine Teilgruppe der Flüchtlinge bedarf nach stabilisierenden Interventionen einer längeren traumaspezifischen Behandlung, meist im zweiten Schritt. Eine adäquate psychosoziale Versorgung stellt eine entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Integration in die fremde Kultur und ein zunächst oft verunsicherndes neues soziales Umfeld dar.
Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe für die Zukunft, in den verschiedenen Aus- und Fortbildungsbereichen der Gesundheit standardmäßig migrationsspezifische Inhalte und relevante kulturelle Informationen unter Berücksichtigung von Genderaspekten sowie Spezifika im Umgang mit (Bürger)Kriegsopfern zu integrieren. Dies betrifft auch spezialisierte Ausbildungen, z.B. zur transkulturellen Psycho- und Traumatherapie. Zudem ist es notwendig, den Einsatz von Dolmetschenden und Sprachmittlern im Gesundheitswesen rechtlich, finanziell und qualitativ zu regeln und professionellen wie auch Laienhelfern die notwendige Unterstützung und Supervision bereitzustellen.
Literatur
Feldmann RE Jr., Seidler GH: Traum(a) Migration: Aktuelle Konzepte zur Therapie traumatisierter Flüchtlinge und Folteropfer. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2013.
Kizilhan JI: Kultursensible Psychotherapie: Hintergründe, Haltungen und Methodenansätze. Forum Migration Gesundheit Integration, Bd. 8. Aachen: VWB-Verlag, 2013.
Richter K, Lehfeld H, Niklewski G: Warten auf Asyl: Psychiatrische Diagnosen in der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Bayern. Gesundheitswesen 2015; 77: 834–838.
Weitere Infos
UNHCR (2015) UNHCR Mid-Year Trends 2015
Für die Autoren
Prof. Dr. med. Sabine C. Herpertz
Klinik für Allgemeine Psychiatrie
Zentrum für Psychosoziale Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg
Voßstr. 2 – 69115 Heidelberg
eva-maria.goetz@med.uni-heidelberg.de (Sekretariat)