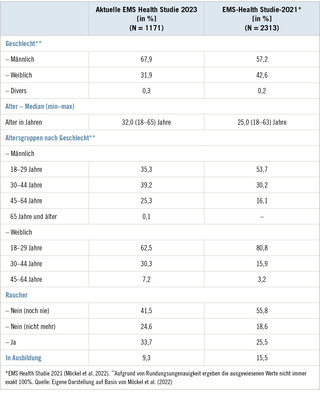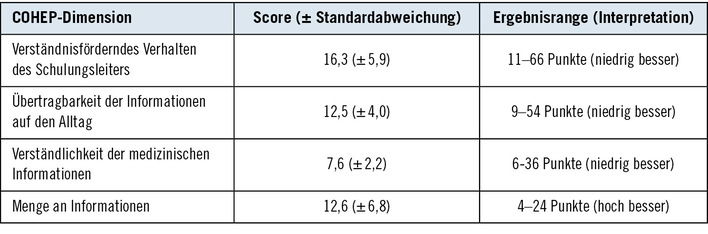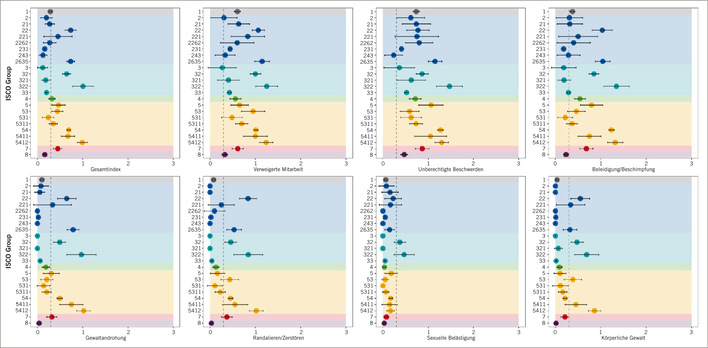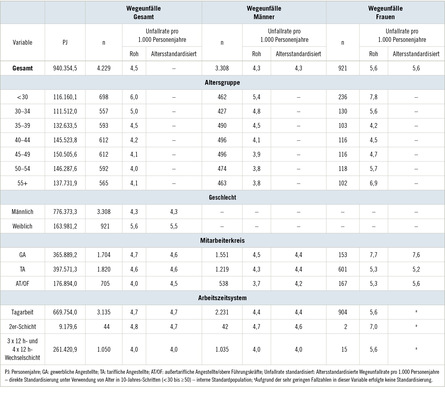Psychische Gesundheit: Arbeitspsychologische Perspektive
Beeinträchtigte psychische Gesundheit wird oft als Problem der beteiligten Personen gesehen, die nicht ausreichend belastbar seien. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass psychosoziale Stressfaktoren nicht direkt wirken, sondern unterschiedlich interpretiert und bewertet werden, weshalb Personen in unterschiedlichem Außmaß Stresssymptome entwickeln. Übersehen wird dabei oft, dass die Bewertung von Stressfaktoren nicht nur individuell ist – sie spiegelt auch allgemein-menschliche und kulturelle Eigenheiten wider, weshalb nicht wenige Stressfaktoren bei vielen Personen Stress auslösen. Man kann nicht einfach sagen: „Stress macht krank“, sehr wohl aber: „Stress erhöht das Risiko, krank zu werden“. Gravierende Konsequenzen ergeben sich allerdings in der Regel nicht aus einzelnen belastenden Situationen oder Episoden. Kritisch wird es vielmehr dann, wenn die Situation über lange Zeit anhält und keine ausreichende Erholung mehr zulässt. Beteiligt sind daran meist nicht einzelne Stressereignisse als vielmehr Gesamtkonstellationen, in denen den Stressfaktoren nicht genügend Ressourcen gegenüberstehen. Dann steigt das Risiko, dass sich Stresssymptome entwickeln, z.B. Schlafprobleme, muskuloskelettale Verspannungen, Schweißausbrüche, steigende Irritierbarkeit, depressive Verstimmungen, erhöhter Blutdruck. Auf die Dauer wird auch die Leistung beeinträchtigt, obgleich viele die sinkende Leistungsfähigkeit über längere Zeit durch steigende Anstrengung kompensieren. Diese Entwicklungen gehen in der Regel langsam und sind zunächst meist reversibel, bessern sich also, wenn sich die Situation bessert. Wenn sie aber lange Zeit andauern, verfestigen sich die Symptome jedoch und sind nicht mehr ohne weiteres reversibel. Interessante Arbeit, die mit bewältigbaren Herausforderungen verbunden ist, ausreichend Erholung, Unterstützung und Anerkennung sowie gute berufliche Perspektiven sind Elemente, die nicht nur der Gesundheit der Beschäftigten sondern auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen zuträglich sind.
Schlüsselwörter: psychosoziale Stressfaktoren – Stressorkonstellationen – Risiko der Entwicklung von Stresssymptomen – bewältigbare Herausforderungen
Mental health: Work psychology perspective
Impaired mental health is often seen as an individual problem (low resilience). This impression is supported by the fact that psycho-social stressors do not have direct effects; rather, they are interpreted and appraised differently, resulting in different individuals developing stress symptoms to different degrees. However, stressor appraisals are not only individual; they also reflect general human and cultural characteristics, thus resulting in similar reactions by many people. It is not appropriate to say «stress makes sick»; rather, stress augments the risk of becoming sick. Grave consequences usually do not result from single situations or episodes; rather, they emerge if the situation lasts over a long time and recovery is impaired. Typically, it is not single events but rather constellations of various stressors, combined with insufficient resources to counter these stressors, that increase the risk for stress-symptoms such as sleep problems, musculoskeletal symptoms, sweating, irritability, depressive mood, or high blood pressure. In the long run, performance will suffer, although many try to compensate for deteriorating performance capability by compensatory effort. Such developments are usually slow and initially reversible in that they improve if the situation improves. Over long periods of time, however, symptoms become chronic and are not easily reversed any more. Work that is interesting, contains challenges that are manageable, implies enough opportunity for recovery, is associated with support and appreciation, and offers good employment perspectives is conducive not only to the good health of the employees but also to the economic prosperity of the company.
Keywords: psycho-social stressor – stressor constellations – risk for stress symptoms – manageable challenges
Beeinträchtigte psychische Gesundheit als ernstzunehmendes Problem
Psychosoziale Stressoren und psychische Gesundheit werden nicht selten als Probleme der betroffenen Personen betrachtet; sie gelten als wenig belastbar, als überempfindlich oder klagsam, es wird ein Mangel an Motivation und Engagement vermutet. Ein möglicher Grund für diese Skepsis ist sicher darin zu sehen, dass viele psychische Veränderungen nicht direkt sichtbar sind (wenngleich sich das derzeit mit der Zunahme von neuropsychologischen Untersuchungen ändert). Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass wir es im Arbeitsalltag überwiegend nicht mit psychischen Störungen im klinischen Sinn, wie Depression zu tun haben, die dann eher als Krankheit anerkannt werden, sondern eher mit beeinträchtigtem Befinden (z.B. depressiven Stimmungen), die sich allenfalls über lange Zeit zu klinischen Störungen entwickeln (Mohr 1986). Hinzu kommt, dass die Stressoren, die als Auslöser solcher Befindensbeeinträchtigungen gelten können (Rothe et al. 2017), nicht direkt wirken – sie müssen von der Person wahrgenommen und interpretiert werden. Solche Interpretationen („appraisal“) sind ebenso wie die Versuche, Stress zu bewältigen, naturgemäß zwischen Individuen ziemlich verschieden, und so finden sich unter sehr ähnlichen Bedingungen Menschen, die dadurch in Stress geraten, aber auch solche, die gut damit zurechtkommen, ja sogar einige, die – jedenfalls für eine gewisse Zeit – dabei aufleben. Diese interindividuellen Unterschiede legen nahe, die Rolle der Arbeitsbedingungen (Stressoren und Ressourcen) für die Entstehung von Befindensbeeinträchtigungen zu unterschätzen und die Ursachen ausschließlich in der Person oder in privaten Verhältnissen zu sehen. Schließlich gelingt es vielen, mit Stress recht gut umzugehen, und manchmal kann der Eindruck entstehen, jemand müsse sich nur „zusammennehmen“ (Zapf u. Semmer 2004).
Dass deutliche Befindensbeeinträchtigungen in der Regel bei einer Minderheit der Beschäftigten zu finden sind, bestärkt diesen Eindruck. Übersehen wird dabei oft, dass Ähnliches durchaus auch im Bereich der körperlichen Gesundheit gilt: Nicht alle, die einem Virus ausgesetzt sind, werden krank, und nicht alle, die davon krank werden, sterben auch davon. Es kommt hinzu: Viele nehmen sich tatsächlich zusammen. Präsentismus ist heute ein Problem, d.h. Menschen gehen zur Arbeit, obwohl es ihnen nicht gut geht; sie wollen die anderen nicht im Stich lassen, die Stelle nicht gefährden, Arbeiten zu Ende führen. Das ist häufig Ausdruck von Gewissenhaftigkeit und Leistungsbereitschaft. Tatsächlich haben sich viele, die ein Burnout entwickeln, über lange Zeit „zusammengenommen“ und dadurch lange durchgehalten, aber dabei ihre Ressourcen so nachhaltig untergraben, dass es irgendwann einmal nicht mehr geht. Präsentismus ist denn auch ein Risikofaktor (Igic et al. 2017a; Kivimäki et al. 2003).
Dieses Problem führt zunächst zu einer wichtigen Schlussfolgerung: Es kann nicht einfach gesagt werden „Stress macht krank“. Was aber gesagt werden kann ist: „Stress erhöht das Risiko, krank zu werden“ (Zapf u. Semmer 2004). Die Interpretation durch die jeweils Betroffenen spielt dabei, wie gesagt, eine wichtige Rolle. Aber diese Interpretation spiegelt vielfach eben nicht nur individuelle Merkmale wider, sondern vielmehr auch menschliche Gemeinsamkeiten. Wenn bei potenziell unfallträchtigen Arbeiten das Risiko von Verletzungen bereits nach zweistündigem ununterbrochenem Arbeiten im Vergleich zu einer Situation mit einer nach 30 Minuten erfolgenden Pause deutlich höher ist (Tucker et al. 2003), wenn Unternehmen, die im Vergleich zu anderen Betrieben, gute psychosoziale Arbeitsbedingungen bieten, auch ökonomisch besser abschneiden (Harter et al. 2010), und wenn Assistenzärztinnen und -ärzte nach langen Schichten auf dem Nachhauseweg mehr Unfälle haben als nach regulären Schichten (Barger et al. 2005), dann geht es nicht mehr nur um individuelle Probleme, sondern auch um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
Weiterhin spielen kulturelle Gemeinsamkeiten eine Rolle, denn sie bestimmen gesellschaftliche Normen. Autoritäres Verhalten von Führungskräften wurde in früheren Jahrzehnten oft noch als angemessen und zulässig angesehen – heute wird es eher als unangemessen und ungerecht empfunden und kann dementsprechend Stress auslösen (Felfe et al. 2014).
Stress und beeinträchtigte Gesundheit
Was sind die „Befindensbeeinträchtigungen“, von denen hier die Rede ist? Dazu zählen beispielsweise Schlafprobleme, muskuloskelettale Verspannungen, Schweißausbrüche, Herzklopfen – Beschwerden, die oft als „psychosomatische“ Beschwerden zusammengefasst werden. Auch eine hohe Irritierbarkeit gehört dazu, Schwierigkeiten, nach der Arbeit abzuschalten und stattdessen über Probleme der Arbeit nachzugrübeln („Rumination“); Ängste (z.B. Angst um den Arbeitsplatz; Versagensängste, Angst vor Auseinandersetzungen, die mit Demütigung und Herabwürdigung verbunden sind); Unzufriedenheit, Selbstzweifel und depressive Gedanken. Das sind alles Erlebnisse oder Zustände, die im Leben ab und zu auftreten – sie werden aber zum Problem, wenn sie sich verfestigen. Sie erhöhen das Risiko physischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Krankheiten und deren Vorläufer (Blutdruck). Sie beeinträchtigen die Leistung und erhöhen das Risiko von Fehlern (und Unfällen); sie erhöhen das Risiko von Konflikten. Und sie „strahlen aus“, d. h. sie beeinträchtigen die Balance zwischen Arbeit und Privatleben und erhöhen das Risiko familiärer Konflikte. Dieser Prozess ist häufig schleichend: Über relativ lange Zeit kann mit vielem umgegangen werden; auf die Dauer werden aber die eigenen Bewältigungsressourcen geschwächt, die Bewältigung gelingt immer weniger (s. Juster et al. 2010; Sonnentag u. Frese 2013; Siegrist 2015; Semmer u. Zapf 2018).
Wovon hängt es ab, ob sich solche Probleme entwickeln? Die Einflüsse sind natürlich vielfältig, aber mit Sicherheit spielt Stress – keineswegs nur, aber auch in der Arbeit – eine wichtige Rolle. Unter Stress versteht der Autor einen Zustand unangenehmer Anspannung. Dieser wird ausgelöst durch zwei Arten von Ungleichgewicht (Edwards 1996): Das erste Ungleichgewicht bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten – die Menge der Arbeit ist nicht mehr zu bewältigen; Anrufe oder E-Mails am Abend beeinträchtigen den Erholungsprozess; vielfältige Anforderungen sind nicht mehr „unter einen Hut“ zu bringen usw. Das zweite Ungleichgewicht besteht zwischen Bedürfnissen und den „Angeboten“ zu ihrer Befriedigung. Wenn ständig Streit herrscht, wenn Feedback ausbleibt, wenn Ungerechtigkeit, Respektlosigkeit und Misstrauen erlebt werden, dann werden die Bedürfnisse nach einem guten sozialen Klima, nach Fairness, Respekt und Anerkennung verletzt. Für diese beiden Diskrepanzen können sich auch gegenläufige Effekte ergeben, wenn sich Betroffene etwa über längere Zeit über Gebühr anstrengen müssen (zu hohe Anforderungen), durch den dabei erzielten Erfolg aber Bestätigung und Anerkennung erfahren (Bedürfnisbefriedigung). Hierbei handelt es sich um „Challenge-Stressoren“: Sie fördern einerseits das Selbstbewusstsein, andererseits aber – gleichzeitig! – auch Stresssymptome und können auf Dauer die Gesundheit untergraben (Semmer u. Zapf 2018; Widmer et al. 2012).
Stresserlebnisse sind im Normalfall (d.h. wenn sie nicht traumatisch sind) oft relativ harmlos. Bedenklich werden sie durch zwei Komponenten:
- Es entstehen Konsequenzen unmittelbar in der Stresssituation, beispielsweise Unfälle oder Fehlurteile.
- Der Stresssituation folgt keine ausreichende Erholung (Sonnentag u. Fritz 2015; Wendsche u. Lohmann-Haislah 2017).
Stress, der chronisch wird und nicht durch Erholung kompensiert werden kann, stellt somit in der Regel das eigentliche Risiko dar (McEwen 1998). Unter chronischem Stress steigt das Risiko, dass sich Stresssymptome entwickeln, die in Ausmaß und Dauer bedenklich sind (z.B. deutliche und über lange Zeit anhaltende Schlafprobleme). Effekte können sich kumulieren, d.h. sie werden mit anhaltendem Stress größer. Zudem spricht vieles dafür, dass diese Effekte zwar zunächst noch reversibel sind, sich aber verfestigen und irrreversibel werden, wenn der Stress über lange Zeit anhält – also nicht mehr, oder nur in geringem Maße, zurückgehen, wenn der Stress nachlässt (Igic et al. 2017a), etwa, wenn Schichtarbeiter, die die Schichtarbeit aus gesundheitlichen Gründen verlassen, davon gesundheitlich nicht profitieren (Frese u. Semmer 1986).
Wie der Bericht der BAUA zu dem Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“ (Rothe et al. 2017) zeigt, ist inzwischen einiges darüber bekannt, welche Faktoren in der Arbeit die Entwicklung von Stresssymptomen begünstigen. Das Gleiche gilt für protektive Faktoren – die Ressourcen, die immer mit berücksichtigt werden müssen. So wie Stressoren dazu beitragen, dass Stress entsteht, so können Ressourcen dazu beitragen, Stress zu vermeiden, zu vermindern oder besser zu bewältigen. Beispiele sind etwa Handlungsspielräume (Autonomie), die es möglich machen, die Art (und oft auch die Zeit) der Ausführung einer Aufgabe an die eigenen Stärken und Präferenzen anzupassen, soziale Unterstützung, die tatkräftige Hilfe, aber auch emotionale Unterstützung bieten kann, oder auch Wertschätzung, die einen potenziell angegriffenen Selbstwert stützen kann. Hinzu kommen persönliche Ressourcen (Selbstwert, Stressbewältigungsstrategien) sowie Unterstützung aus dem privaten Bereich (Zapf u. Semmer 2004).
Auch wenn das Zusammenwirken einzelner Stressoren und Ressourcen vielfach untersucht wird, ist über Art und Bedeutung von Gesamtkonstellationen noch relativ wenig bekannt. Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen (Effort-Reward-Imbalance-Modell; Siegrist 2015) sieht im Verhältnis von Anforderungen und Gratifikationen (Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit und Aufstiegsmöglichkeiten sowie Anerkennung) den entscheidenden Aspekt. Die empirische Vorhersage von physischer (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) wie auch psychischer (z.B. Depression) Gesundheit in vielen Studien ist beeindruckend. Igic et al. (2017b) verfolgen mit dem Job-Stress-Index (JSI) einen ähnlichen Ansatz. Sie zeigen, dass ungünstige Ausprägung des JSI (Differenz Ressourcen-Stressoren) Erschöpfung zu einem späteren Zeitpunkt vorhersagte; zudem ging eine Verschlechterung/Verbesserung des JSI mit entsprechenden Änderungen in der Erschöpfung einher.
Schlussfolgerung
Sinnerfüllte Arbeit, die anspruchsvoll, aber bewältigbar ist, die in einem guten sozialen Klima ausgeführt werden kann und ausreichend Autonomie und Unterstützung bietet, die ein gesichertes Einkommen bietet und anerkannt wird – Merkmale dieser Art sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich die Beschäftigten in der Arbeit wohl fühlen und sich mit ihr identifizieren können und dass sie physisch wie psychisch gesund bleiben. Sie sind auch wichtige Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen effizient arbeiten und dass die Beschäftigten bis zur Verrentung in der Arbeit bleiben können. Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit in der Arbeit sind nicht vernachlässigbare Empfindlichkeiten, sondern handfeste gesellschaftliche, gesundheitliche und ökonomische Probleme. Das gilt auch unter den Bedingungen einer sich verändernden Arbeitswelt.
Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.
Literatur
Barger LK, Cade BE, Ayas NT, Cronin JW, Rosner B, Speizer FE, Czeisler CA: Extended work shifts and the risk of motor vehicle crashes among interns. N Engl J Med 2005; 352: 125–134.
Edwards JR: An examination of competing versions of the person-environment fit approach to stress. Acad Manage J 1996; 39: 292–339.
Felfe J, Ducki A, Franke F: Führungskompetenzen der Zukunft. In: Badura B, Ducki A, Schröder H, Klose J, Meyer M (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2014. Berlin: Springer, 2014, S. 139–148.
Frese M, Semmer N: Shiftwork, stress, and psychosomatic complaints: A comparison between workers in different shiftwork schedules, non-shiftworkers, and former shiftworkers. Ergonomics 1986; 29: 99–114.
Harter JK, Schmidt FL, Asplund JW, Killham EA, Agrawal S: Causal impact of employee work perceptions on the bottom line of organizations. Perspect Psychol Sci 2010; 5: 378–389.
Igic I, Elfering A, Semmer N, Brunner B, Wieser S, Gehring K, Krause K: Job-Stress-Index 2014 bis 2016, Kennzahlen zu psychischer Gesundheit und Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz. Theoretische Grundlagen, Methodik und Ergebnisse für die Jahre 2014 bis 2016 in Quer- und Längsschnitt. Bern, Lausanne: Gesundheitsforderung Schweiz Arbeitspapier 43, 2017a.
Igic I, Keller AC, Elfering A, Tschan F, Kälin W, Semmer NK: Ten-year trajectories of stressors and resources at work: Cumulative and chronic effects on health and well-being. J Appl Psychol 2017b; 102: 1317–1343.
Juster RP, McEwen BS, Lupien SJ: Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neurosci Biobehav Rev 2010; 35: 2–16.
Kivimäki M, Head J, Ferrie JE, Shipley MJ, Vahtera J, Marmot MG: Sickness absence as a global measure of health: Evidence from mortality in the Whitehall II prospective cohort study. Br Med J 2003; 327: 364–469
McEwen BS: Protective and damaging effects of stress mediators. N Engl J Med 1998; 338: 171–179.
Mohr G: Die Erfassung psychischer Befindensbeeinträchtigungen bei Industriearbeitern. Frankfurt: Lang, 1986.
Rothe I, Adolph L, Beermann B, Schütte M, Windel A, Grewer A, Lenhardt U, Michel J, Thomson B, Formazin M: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017.
Semmer NK, Zapf D: Theorien der Stressentstehung und -bewältigung. In: Fuchs R, Gerber M (Hrsg.): Handbuch Stressregulation im Sport. Berlin: Springer, 2018, S. 23–50.
Siegrist J: Arbeitswelt und stressbedingte Erkrankungen: Forschungsevidenz und präventive Maßnahmen. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2015.
Sonnentag S, Frese M: Stress in organizations. In: Schmitt NW, Highhouse S (eds.): Handbook of psychology. Vol. 12, 2nd ed.. Hoboken, NJ: Wiley, 2013, pp. 560–592.
Sonnentag S, Fritz C: Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework. J Org Behav 2015; 36: S72-S103.
Tucker P, Folkard S, Macdonald I: Rest breaks and accident risk. Lancet 2003; 361: 680.
Wendsche J, Lohmann-Haislah A: Detachment als Bindeglied zwischen psychischen Arbeitsanforderungen und ermüdungsrelevanten psychischen Beanspruchungsfolgen: Eine Metaanalyse. Z Arbeitswiss 2017; 71: 25–70.
Widmer PS, Semmer NK, Kälin W, Jacobshagen N, Meier LL: The ambivalence of challenge stressors: Time pressure associated with both negative and positive well-being. J Vocational Behav 2012; 80: 422–433.
Zapf D, Semmer NK: Streß und Gesundheit in Organisationen. In: Schuler H (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie III, Band 3: Organisationspsychologie. 2. Aufl.. Göttingen: Hogrefe, 2004, S. 1007–1112
Verfasser
Prof. em. Dr. phil. Norbert K. Semmer
University of Bern, Department of Psychology
Fabrikstr. 8
3012 Bern, Switzerland
ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2018; 53 (Sonderheft): 54–56
Fußnoten
University of Bern, Department of Psychology