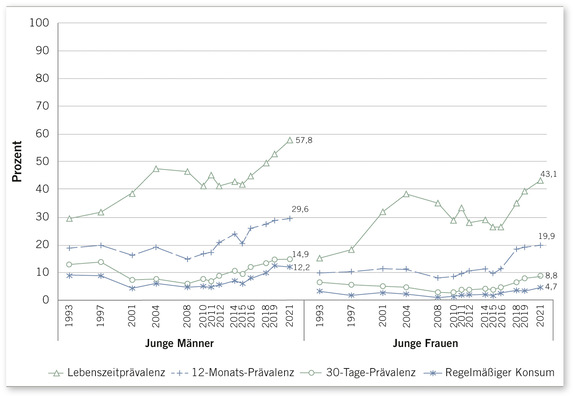Versicherte, die infolge von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten bei der Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit beeinträchtigt sind, wenden sich an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, damit diese sie bei der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben bestmöglich unterstützen. Das gilt auch bei spezifischen Verletzungen, die nicht unbedingt gravierend sind, sich im Job aber negativ auswirken, wie zum Beispiel Handverletzungen.
Was ändert sich jetzt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) für die berufliche Rehabilitation? Welche Rolle spielt die gesetzliche Unfallversicherung? Und wer profitiert vom neuen Gesetz? „Nicht alles ist neu, aber die Durchlässigkeit auf dem langen Weg der Wiedereingliederung erhöht sich entscheidend“, sagt Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Hauptgeschäftsführer der BGW.
Herr Professor Brandenburg, das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen durchsetzen und fördern. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ideen?
Für den Gesetzgeber ist „Arbeit“ der zentrale Bereich für die Teilhabe. Genauso sieht das auch die gesetzliche Unfallversicherung, obwohl Familie und Gesellschaft natürlich ebenfalls wichtig sind. Und sicher fängt das BTHG nicht völlig bei Null an. Auch zuvor gab es im Sozialgesetzbuch IX Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Neu ist der Ansatz, so weit wie möglich die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu fördern und die Betroffenen bei Entscheidungsprozessen wesentlich stärker einzubeziehen.
Was verändert sich konkret für die berufliche Rehabilitation?
Das BTHG sorgt für deutlich mehr Durchlässigkeit auf dem langen Weg der Wiedereingliederung. Viele Menschen erwerben eine Behinderung durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung während ihres Arbeitslebens. Wer auf Unterstützung wie persönliche Assistenz oder Therapie aus der Eingliederungshilfe angewiesen war, musste bisher jede Reha-Leistung einzeln bei den verschiedenen Leistungsträgern beantragen. Sie können sich vorstellen, wie hoch der bürokratische Aufwand bei einem derartigen Verfahren ist.
Das BTHG trennt jetzt Eingliederungshilfe von Sozialhilfe und Leistungen zum Unterhalt. Die Rehabilitanden können künftig mitentscheiden, welche Maßnahmen sie brauchen. Sie können diese Leistungen über ein persönliches Budget praktisch völlig selbstbestimmt einkaufen, müssen aber nachweisen, wofür sie das Budget dann letztlich ausgegeben haben.
Außerdem reicht ein einziger Antrag, um alle Leistungen wie aus einer Hand zu beziehen, weil die Zusammenarbeit der Reha-Träger über das Teilhabeplanverfahren entsprechend geregelt wird. Das gesamte Handling wird leichter und auch die Abstimmung zwischen den Trägern ist nun klar geregelt.
Ein weiterer Vorteil für die Betroffenen liegt darin, dass Einkünfte und Vermögen künftig in viel geringerem Umfang bei der Eingliederungshilfe herangezogen werden. Beispielsweise erhöhen sich die Freibeträge für Erwerbseinkommen ebenso wie der Schonbetrag für Barvermögen, und das Vermögen der Ehepartner bleibt anrechnungsfrei.
Aus der Perspektive der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist das Budget für Arbeit sicher eine Neuerung, von der sie profitieren können. Beispielsweise liegt der Lohnkostenzuschuss, der „Minderleistungen“ ausgleichen soll, die durch die Behinderung entstehen, bei bis zu 75 % vom Entgelt der Betroffenen. Interessant wäre es, hier nach einer Zeit einmal zu evaluieren, was diese zusätzliche Förderung des Wiedereintritts bringt.
Was verändert sich für die gesetzliche Unfallversicherung und ihre Versicherten?
Das Teilhabegesetz löst ein paar Probleme, die wir so in der gesetzlichen Unfallversicherung gar nicht hatten. Reha-Leistungen, die mit einem einzigen Antrag ermöglicht werden, sind für uns nicht neu. Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten trägt die gesetzliche Unfallversicherung seit jeher die Sorge für alle Aspekte. Umwege über die Kranken- oder Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit oder das Sozialamt gab es für unsere Versicherten schon vor dem Inkrafttreten des BTHG nicht.
Eine Erläuterung zur sozialpolitischen Bedeutung des persönlichen Budgets: Es besteht ein Rechtsanspruch darauf, den Maßnahmenplan selbst zu gestalten. Die Unterstützungsleistungen für jeden Einzelnen werden im Teilhabeplan festgelegt. Leistungsträger und Empfänger besprechen sich dazu in einer Teilhabekonferenz auf Augenhöhe. Durch das neue Verfahren ändert sich die Kommunikation mit den Versicherten. Es erfordert von uns als Versicherung mehr Flexibilität. Außerdem haben alle Leistungsträgerinnen und -träger die Pflicht, zum persönlichen Budget zu beraten.
Welche Rolle spielt die BGW als Unfallversicherung für Menschen in den Werkstätten oder für Integrationsunternehmen?
Die BGW versichert unter anderem auch die Beschäftigten in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Dazu gehören auch diejenigen, die in den Beschäftigungsbereichen dieser Einrichtungen tätig sind und betreut werden. Integrationsunternehmen, die im Wettbewerb tätig sind und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaffen, sind ebenfalls Versicherte der BGW. Auch das ist relativ neu.
Ende 2014 gab es deutschlandweit 842 solcher Inklusionsbetriebe, die Arbeitsplätze für einzelne oder für Gruppen von Menschen mit Behinderungen schaffen. Ihre Anzahl wächst ständig. Und sie decken sehr unterschiedliche Branchen ab, von der Produktion bis zum Restaurant. Die Regeln sind für die unterschiedlichen Branchen gleich. In einem Inklusionsbetrieb müssen mindestens 25 %, mittelfristig sogar 30 % und in der Regel maximal 50 % der Beschäftigten eine Schwerbehinderung haben.
Auch wenn viele Regeln zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gleich sind, gibt es Betriebssicherungsvereinbarungen, deren Ausführungen sehr unterschiedlich sind und die angepasst werden sollten, je nachdem, welche Aspekte und welche Behinderungen der Beschäftigten berücksichtigt werden müssen.
Ein großes Thema auch für die BGW ist die Mobilität. Wie kommen die Menschen zur Arbeit? In die Werkstatt kamen sie mit dem Bus. Jetzt müssen sie die Anreise oft komplett selbst organisieren. Grundsätzlich sind sie auf dem Weg zur Arbeit und zurück aber über die BGW versichert.
In jedem Betrieb müssen außerdem Gefahrenstellen entsprechend festgestellt werden. Hinzu kommen Regeln und Trainings zur Verhaltensprävention. Die BGW unterstützt die sichere Mobilität im Straßenverkehr, die Betroffenen sollten gerade hier in der Lage sein, sich sicher zu bewegen. Auch der richtige Umgang mit bestimmten Maschinen im Unternehmen muss erlernt werden, weil die Maschine sonst eventuell zum Risikofaktor werden kann. Hier sind Anleitungen in leichter Sprache gefragt.
Welche Perspektive sehen Sie für die Werkstätten?
Grundsätzlich halte ich Werkstätten für Menschen mit Behinderungen für unverzichtbar. Es wird immer Menschen geben, die so schwere Einschränkungen haben, dass sie die institutionelle Fürsorge und den Schutzraum brauchen.
Die Werkstätten werden sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt gegenüber jedoch noch stärker öffnen. Neben den klassischen Einrichtungen könnten beispielsweise ausgelagerte kleinere Einheiten für Rehabilitanden entstehen, die sich in einer solchen Umgebung besser entfalten können. Hier könnten Arbeitsplätze geschaffen werden, die individuell ausgerichtet sind und viel Freiraum zum Ausprobieren lassen. Große Betriebe haben ja oft ein bestimmtes Portfolio und reagieren auf den Markt weniger flexibel als kleinere Einheiten.
Das BTHG sieht vor, dass Alternativen zur Werkstatt geschaffen werden. Das Budget für Arbeit soll die Bereitschaft von Unternehmen fördern, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Darüber hinaus sollen andere Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen zugelassen werden, und Integrationsunternehmen profitieren von staatlichen Fördermaßnahmen.
In den 1960er-Jahren hat das Prinzip der „Fürsorge“ den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Menschen mit Behinderungen bestimmt. Wie sieht das heute aus?
Fürsorge für Bedürftige bleibt eine Qualität des Sozialstaats, soll aber nicht mehr von oben, ohne Mitsprache der Betroffenen und nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Stattdessen müssen sich die Hilfen konsequent an den Bedürfnissen der Einzelnen orientieren. Was ist das Beste für den Menschen? Darum geht es. Wo lassen sich neue Möglichkeiten ausschöpfen?
Wir müssen bei jedem und jeder Einzelnen schauen, wie sich der Lebenslauf gemeinsam gestalten lässt. Heute gilt nicht mehr das Prinzip „einmal Werkstatt – immer Werkstatt“. Fürsorge ja, aber so weit wie möglich verknüpft mit Selbstbestimmung. Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass man sich ein Stück weit wegbewegt vom tradierten und in der Vergangenheit bestimmt auch manchmal übertriebenen Fürsorgeprinzip.
Wie lässt sich messen, ob Strategien, Maßnahmen und Projekte für mehr Teilhabe wirklich erfolgreich sind?
Geht es um die Ergebnisse, sollten wir uns fragen, durch welche messbaren Kriterien Inklusionserfolge darstellbar sind. Dazu einige Beispiele: Werden Funktionsbeeinträchtigungen verbessert und dies eventuell auch über die Hilfsmittelversorgung? Der Erfolg kann außerdem daran gemessen werden, ob und inwieweit jemand wieder Fuß fasst im Erwerbsleben. Kann er oder sie zurückkehren in den ersten Arbeitsmarkt?
Die zweite Ebene betrifft die Sicht der Menschen mit Behinderungen. Wie erleben Bedürftige die Hilfen? Können wir feststellen, ob die Lebensqualität positiver ist als vorher? Das ist bei vielen aus der Gruppe der Betroffenen schwieriger zu evaluieren.
„Wir sind nicht behindert – wir werden behindert“, was halten Sie von diesem Satz?
Im Kern ist das richtig. Mir fallen genügend Beispiele ein, wo das zutrifft und man sich bis heute so verhält, dass körperliche oder geistige Einschränkungen zur Barriere gemacht werden, ohne dass es so sein müsste. Denken Sie doch nur mal an die so genannten Sonderschulen. Bei der Entscheidung, ob diese Schulform für einen Menschen mit einer Behinderung der richtige Schritt für die Zukunft ist, tragen Eltern und Lehrkräfte eine hohe Verantwortung. Richtigerweise steht dabei heute das Bestreben im Vordergrund, soweit wie möglich – auch mit Unterstützungsmaßnahmen – eine Schulbildung im allgemeinen Klassenverbund zu ermöglichen, um eine frühzeitige „Barriere“ in Bezug auf den weiteren Bildungsweg zu vermeiden.
Es kann sich aber auch herausstellen, dass eine Förderschule nach den individuellen Gegebenheiten die besseren Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Das individuelle Maximum an Entwicklungschancen sollte die Richtschnur bei den Entscheidungen sein. Nur das entspricht dem Begriff der „Behinderung“, den die UN-Behindertenrechtskonvention völlig neu fasst – als Wechselwirkung zwischen dem Menschen mit seiner Beeinträchtigung und den einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die ihm begegnen.
Quelle