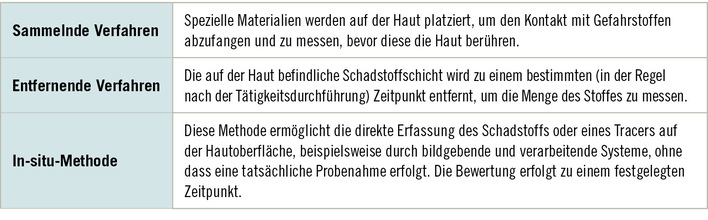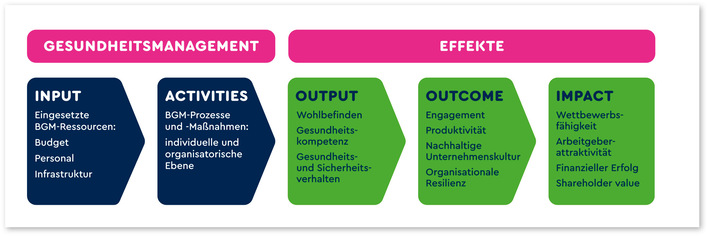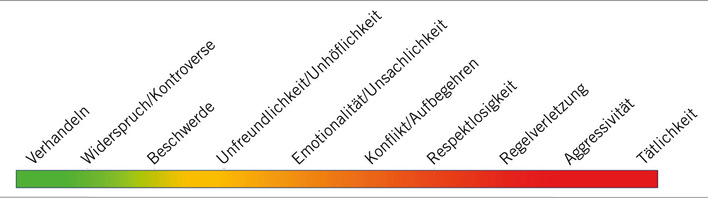Hintergrund
Apps können aufgrund der steigenden Marktpenetration von Smartphones und Tablets auch im Bereich des Präventions- und Gesundheitsmanagements als neuer Trend angesehen werden. Denn über die Hälfte aller Bundesbürger über 14 Jahre (49 %) besitzen ein Smartphone (BVDW 2013). Jeder fünfte von ihnen nutzt laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbands bereits Gesundheits-Apps (AOK-Bundesverband 2013). Genutzt wer-den Gesundheits-Apps vor allem, um Fitness- und Trainingsdaten (38 %), das Essverhalten (31 %), den Gewichtsverlauf (12 %) oder den Menstruationszyklus (7 %) zu dokumentieren oder um Blutdruckdaten zu verwalten (5 %; Fox u. Duggan 2012). Dass die Einsatzbereiche vielfältig sind, zeigt die Datenbank MyHealthApps.net mit 370 Apps in 47 Sprachen und derzeit 150 unterschiedlichen Einsatzgebiete, angefangen vom Finder von Behinderten-Toiletten über Muttermal-Scanner bis hin zu Blutdrucktagebücher ( http://www.myhealthapps.de; Stand 01. 04. 2014).
Aktuelle Erkenntnisse über NutzerInnen
Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf Gesundheits-Apps. Diese Apps sind von Medizin-Apps abzugrenzen, da Medizin-Apps, die zur Therapie und Diagnose von Krankheiten oder zur Dosiskalkulation eingesetzt werden, unter den § 3 des Medizinproduktegesetzes fallen und ein spezielles Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Gesundheits-Apps hingegen unterliegen keiner regulatorischen Kon-trolle. Sie können gemäß der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1946 als mobile Applikationen bezeichnet werden, die das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden (WHO 2006) positiv und nachhaltig auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse beeinflussen sollen (Scherenberg u. Kramer 2013). Ob Gesundheits-Apps im Präventionsbereich (z. B. Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Vorsorge) tatsächlich dabei helfen können, auch fest verankerte behaviorale Risikoverhaltensweisen von Menschen (z. B. Rauchen) zu verändern, darüber fehlen bisher wissenschaftliche Langzeitstudien. Erste Studien lassen lediglich vermuten, dass Apps durchaus zur Verhaltensänderung anregen können: So zeigte eine Studie zur mobilen Nutzung eines digitalen Ernährungstagebuchs, dass besonders Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen App-affin sind und ihr Ernährungsverhalten kontrollieren bzw. „tracken“ (Daugherty et al. 2012). Anhänger der so genannten Bewegung „The Quantified Self“ (Das gemessene Selbst), die regelmäßig sämtliche Körperfunktionen und -bedürfnisse erfassen, nehmen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland kontinuierlich zu (siehe http://quantifiedself.com ). Besonders beliebt ist das Vermessen von körperlichen Aktivitäten (Laufen, Gehen etc.) und Körperdaten (z. B. Body-Maß-Index) (Gimpel u. Nißen 2013). Respektive bei technikaffinen, männlichen Nutzer scheinen Tracking- und Gesundheits-Apps Motivationseffekte auszulösen. So gaben bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes 42 % Männer (und 30 % Frauen) an, dass sich ihr Gesundheitsverhalten durch Gesundheits-Apps positiv verbessert hat (AOK-Bundesverband 2013). Ob diese (Technik-)Begeisterung anhält, bleibt abzuwarten, denn laut „Mobil Health Report“ sind es eher Frauen, unter 50 Jahre mit einem hohen Bildungsstatus und Haushaltsnettoeinkommen, bei denen innerhalb der letzten 12 Monate eine Veränderung im Gesundheitszustand aufgetreten ist (Fox u. Duggan 2012), die Gesundheits-Apps nutzen. Entsprechend scheinen der persönliche Leidensdruck und Nutzen ein persönliches Motiv dafür zu sein, ob Apps genutzt werden oder nicht. Über Langzeitverhaltensweisen exis-tieren derzeit wenige Studien. Erste Untersuchungen zeigen, dass viele Apps oft nur zu Testzwecken installiert und oft direkt wieder gelöscht werden (Eimeren u. Frees 2012). Andere offenbaren, dass rund ein Drittel der Apps nach 3 Monaten (Purcell et al. 2010) und rund die Hälfte aller Tracking-Apps nach 24 Monaten nicht mehr genutzt werden (Endeavour Partner 2013).
Pro und Contra aus Nutzersicht
Der Vorteil an Gesundheits-Apps ist, dass Smartphones zum täglichen Begleiter geworden sind, um das eigene Verhalten kontinuierlich und in Echtzeit reflektieren zu können. In Amerika sind es laut einer Studie an 3014 Probanden bereits 69 %, die ihr eigenes Gesundheitsverhalten „tracken“. Während 49 % dies nur im Kopf und 34 % auf Papier tun, sind es rund 21 %, die hierzu bereits moderne Technologien (wie Apps) nutzen (Fox u. Duggan 2013). Allein für das Tracking mit Apps werden im Durchschnitt 95 Minuten der kostbaren Tageszeit geopfert (Gimpel u. Nißen 2013). Dabei sollen Self-Tracking-Technologien, wie beispielsweise digitale Schrittzähler bzw. Apps, in der Lage sein, die Schrittzahl pro Tag um bis zu 43 % zu steigern (Wang 2013). Zu konstatieren ist, dass bei dieser internen Anbieteruntersuchung nur aktive Self-Tracker einbezogen wurden. Gesundheitliche Gefahren wie das Suchtpotenzial sowie die Verdrängung der eigenen Körperwahrnehmung werden bisher noch stark außer Acht gelassen und sollten stärker erforscht werden. Sie sind insbesondere dann gegeben, wenn die neuen Möglichkeiten der Selbstkontrolle und -optimierung dazu verführen, ständig neue eigene Rekorde aufzustellen und die eigenen Leistungen über soziale Medien (z. B. Facebook) mit denen anderer Nutzer in Beziehung gesetzt werden und so eine zusätzliche Vergleichs-, Regulations- und Kontrollebene entsteht. Nutzer müssen sich darüber hinaus auch darüber im Klaren sein, dass eine regelmäßige Nutzung von Tracking-Apps bereits bei geringer Nutzung ein detailliertes Profil über Nutzungs- und Lebensgewohnheiten der Anwender liefert, die zu Marketingzwecken ausgewertet und genutzt werden können (Schollas 2014). Zusammenfassend ist festzustellen, dass Apps besonders dann einen hohen Präventionsnutzen haben, wenn sie dabei helfen, das eigenen Verhalten zu reflektieren, durch positive Verhaltensappelle die Einsicht fördern und alltagstaugliche Umsetzungshilfen bieten, so dass die Nutzer ihre gesundheitsschädliche Verhaltensweisen umstellen und durch veränderte gesundheitsförder-liche Gewohnheiten ersetzen.
Status quo in Deutschland
Besonderes Engagement in Bezug auf Gesundheits-Apps zeigen in Deutschland die gesetzlichen Krankenkassen sowie Unternehmen der Pharmaindustrie. Nach Eigenrecherchen in den beiden App-Stores Google Play und iTunes sowie auf den Internetseiten der GKVn mit den kassen- und gesundheitsbezogenen Suchbegriffen (Keywords: AOK, TK, DAK, Barmer GEK, BKK, IKK, Vorsorge, Ernährung, Bewegung, Stress, Diabetes etc.) können derzeit 42 Krankenkassen-Apps identifiziert werden (Stand 01. 04. 2014, siehe http://www.healthon.de ). 40 dieser Apps haben einen eindeutigen Gesundheitsbezug (z. B. Vorsorgeplaner, Fitness-Apps, Ernährungs-Apps), wobei sich neun Apps zielgruppenspezifisch an junge Familien und Schwangere, Kinder (Zahngesundheit), pflegende Angehörige sowie türkische Mitbürger (Vorsorge) richten.
Der Großteil der Apps ist auf keine spezielle Zielgruppe ausgerichtet. Das derzeitige App-Angebot von Pharmaunternehmen umfasst 29 Apps. Während sich die GKVn stark im Bereich der universell ausgerichteten Primärprävention engagieren, sieht sich die Pharmaindustrie eher als Partner für das Management bestimmter Krankheitsbilder (z. B. Asthma, Allergien) (Scherenberg u. Kramer 2013). Pharma-unternehmen suchen direkte Ansprachemöglichkeiten von Patientengruppen in ihren jeweiligen Produktumfeldern. Kassen scheint es um präventive Einsparungsmöglichkeiten zu gehen sowie um die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Auffällig ist, dass die GKVn für z. B. rund 7 % Diabetiker (Heidemann et al. 2013) derzeit keine App-gestützte Alltagshilfen (Diabetesmanagement) anbieten. Diabetiker sind entweder keine interessante Zielgruppe oder es wird vermutet, dass sie die neue Kommunikationstechnologie nicht nutzen. Für Typ-1-Diabetiker, in erster Linie sind dies Jugendliche und junge Erwachsene, trifft dies nicht zu (Eimeren u. Frees 2014). Auch für andere Versichertengruppen mit Risikofaktoren (z. B. Nichtraucher-Apps) konnten keine App-Angebote der Krankenkassen identifiziert werden, obwohl die Kosten des Rauchens auf ca. 31,3 Milliarden Euro pro Jahr (2008) beziffert werden (Wacker et al. 2013). Zu konstatieren ist, dass bei diesen (Hoch-)Risikogruppen immer die Gefahr besteht, eine Klientel anzuziehen, die wenig attraktiv erscheint.
Qualitätsindikatoren aus Nutzerperspektive
Krankenkassen-Apps stehen Nutzern bisher kostenlos zur Verfügung, da die GKVn ein Interesse daran haben, durch einen Verhaltensänderung Krankheitskosten ein-zusparen. Andere Institutionen bieten in den App Stores u. a.kostenlose Light-Apps an, um die eigentliche Vollversion der App oder App-gestützte Zusatzprodukte zu verkaufen (Waagen etc.). So hat sich der Absatz vernetzbarer Personenwaagen bereits fast doppelt, während sich der Absatz von mobil vernetzten Blutdruckmessgeräten um rund ein Viertel erhöht hat (GfK 2014). Der Preis für eine Gesundheits-App ist kein qualitätsbestimmender Faktor, denn ob Apps kostenpflichtig oder gratis angeboten werden, hängt in erster Linie vom ökonomischen Interesse des Anbieters und der Möglichkeit ab, wie Entwicklungskosten amortisiert werden können. Anhand anonymer Bewertungen anderer Nutzer können Rückschlüsse auf die wahrgenommene App-Qualität gezogen werden. Dies allerdings mit Vorsicht, da 45 % der Nutzer davon ausgehen, dass digitale Bewertungen manipuliert sind (Fittkau u. Maaß 2008). Für gesundheitsbezogene Informationen auf Websites haben sich Orientierungshilfen etabliert, wie das HON-Siegel der Stiftung Health on the Net (HON) oder das afgis-Siegel bewährt. Für Gesundheits-Apps gibt es analoge Ansätze: App-Anbieter können sich freiwillig zur Einhaltung Qualitätskriterien (HealthonApp-Ehrenkodex) verpflichten, deren Einhaltung Anwender selbst überprüfen können. Ein solcher Ehrenkodex erhöht die Qualitätstransparenz, da die Community aller App-Nutzer und Entwickler Verstöße zeitnah feststellen und anzeigen kann, was das Vertrauen in Gesundheits-Apps stärkt. In einem derart dynamischen Markt scheint dies ein pragmatischer Ansatz zu sein, um durch Selbstkontrolle und durch die Stärkung der Entscheidungskompetenz der Nutzer das Qualitätsniveau der angebotenen Gesundheits-Apps zu erhöhen. Neben den angesprochenen Transparenzkriterien sollten Apps über eine einfache bzw. selbsterklärende Menüführung verfügen. Die grafische Darstellung von Messwerten und Daten zur Befindlichkeit (Tagebücher) sowie Erinnerungsfunktionen können ebenfalls hilfreich sein. Haben Apps zu viele Funktionalitäten und „Spielereien“, kann dies kontraproduktiv sein (Sacher 2000).
Fazit
Im günstigsten Falle sollten Gesundheits-Apps dazu führen, dass sich eine gesundheitsförderliche Gewohnheitsänderung im Alltag manifestiert. Dies heißt auch, dass Gesundheits-Apps besonders dann einen Nutzen spenden, wenn sie nicht in eine Abhängigkeit führen, sondern sich im günstigsten Falle langfristig überflüssig machen, weil der Nutzer ihre Unterstützung nicht mehr braucht. Dabei ist anzumerken, dass Apps die individuelle Gefühlslage, die Stärken und Schwächen, die persönlichen Eigenschaften und die individuelle Lebenslage, in der sich der App-Anwender befindet, weder einschätzen noch adäquat darauf reagieren können. Ein situatives, empathisches Agieren zur rechten Zeit und zum rechten Ort ist nur von Menschen zu leisten. Auf mögliche Verhaltensabweichungen, falsche Übungsausführung (z. B. Fitness-Videos) oder auf Rückfälle (z. B. Rauchen) mit Verständnis, Ermutigung und Unterstützung zu reagieren, überfordert das Medium App.
Apps spielen ihre Stärken mit Suchfunktionen, die Angebote im regionalen Kontext anzeigen, sowie mit visuell unterstützen Dokumentationsmodulen, zielgruppengerechten Informationsfiltern und Erinnerungshilfen aus. Der wachsende Zahl von App-Nutzern kann es gelingen, die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn sie durch Aufklärung unterstützt wird, die Aktualität, Qualität und Güte der gesundheitsbezogenen Informationen für die eigenen Zwecke und gesundheitlichen Zielsetzungen selbst zu überprüfen.
Literatur
Das Literaturverzeichnis kann bei der Autorin oder im ASU-Redaktionsbüro ( asu@hvs-heidelberg.de ) angefordert werden.
Weitere Infos
Fox S, Duggan M: Tracking for Health. 2013
Heidemann C et al.: Prävalenz und zeitliche Entwicklung des bekannten Diabetes mellitus – Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt 2013
https://edoc.rki.de/handle/176904/1486
Schollas S: „Make it count“: Selbstoptimierte Körper zwischen Gamification und Marketing, 2014.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/genderstudies/kulturundgeschlecht/pdf/schollas_make.pdf
World Health Organization (WHO): Constitution oft the world health organization. 2006
Für die Autorinnen
Prof. Dr. P. H. Viviane Scherenberg, MPH
Fachbereich Prävention & Gesundheitsförderung
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH
Universitätsallee 18
28359 Bremen